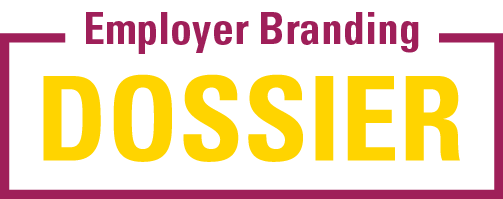„Wir müssen wieder mehr arbeiten.“ Der Satz fällt beiläufig beim Kaffee. Tobias, 59, zuckt. Seit 42 Jahren auf dem Bau. Rücken kaputt, Hände taub. Karpaltunnelsyndrom könnte es sein, meinte mal ein Arzt. Bald ist er 60 – und dann noch sieben Jahre bis zur Rente.
Miriam, 42, Projektleitung, Homeoffice, drei Monitore, lächelt müde: „Ich sitze jeden Abend zwei Stunden länger am Laptop. Offiziell gilt das aber als Freizeit.“ Und Leandro, 29, frisch im Job und in Teilzeit, will nicht Karriere machen, sondern leben. Sagt er. Was für Tobias wie Luxus klingt, ist für ihn schlicht gesund.
Drei Arbeitsrealitäten und Wahrnehmungen – und dreimal das gleiche Thema: Arbeit.
Die Debatte, die gerade durch Talkshows, Interviews und Linkedin-Posts geistert, klingt schlicht: Wir müssen mehr leisten. Mehr Stunden, mehr Einsatz, mehr Jahre. Dann werde es schon wieder. Aber geht diese Formel auf? Und wer ist eigentlich „wir“?
Viele Menschen arbeiten längst mehr statt weniger. Im Homeoffice etwa, wo Pausen verschwinden, Arbeitszeit ausfranst und ständige Verfügbarkeit selbstverständlich wird. Obendrauf kommt die Diskussion über die Lebensarbeitszeit. Weil „wir alle älter werden“, sollen „wir“ auch länger arbeiten, so die Forderungen.
Rechnen mit Durchschnitt – leben mit Ungleichheit
Klingt nach Gleichbehandlung. Aber ist es das? Dass ein Akademiker mit Schreibtischjob im Schnitt fast zehn Jahre länger lebt als jemand, der sein Leben auf Baustellen, in der Pflege oder auf den Knien verbracht hat, wurde bereits 2016 belegt.
Ein Fliesenleger, der mit 16 ins Berufsleben startete, soll also über 50 Jahre durchhalten, während andere mit 27 anfangen und oft früher als geplant in die Frührente wechseln? Diese Logik täuscht. Denn sie ignoriert, wie unterschiedlich Lebensläufe verlaufen. Die politische Debatte arbeitet gern mit Durchschnittswerten. Das Leben tut es nicht.
Erschöpfung ist längst da – nur oft nicht sichtbar
Gleichzeitig wird so getan, als liege das Problem im mangelnden Leistungswillen. Dabei sind viele längst am Limit – auch wenn man es nicht sofort sieht. Die Zahlen sprechen für sich: In den vergangenen zehn Jahren sind die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen um rund 50 Prozent gestiegen. Je nach Studie kommt allein die Diagnose Burn-out inzwischen auf über 180 AU-Tage je 100 Versicherte – pro Jahr.
Miriam sagt: „Ich schaffe 50 Stunden die Woche – aber nur mit Rückenschmerzen und schlechtem Gewissen gegenüber meinen Kindern.“ Tobias sagt nichts mehr. Er schaut auf seine Hände. Und Leandro sagt, was viele seiner Generation denken: „Ich bin nicht faul. Ich will nur nicht krank werden mit 40.“ Was eine alleinerziehende Mutter wohl dazu sagen würde?
Nun reden wir alle über mehr Arbeit, als ginge es nur um Zahlen, statt um Sinn, Wirkung und Gesundheit. Mehr Präsenz ist nicht automatisch mehr Produktivität. Und mehr Lebensarbeitszeit nicht automatisch gerecht.
Auch aus Arbeitgebersicht ist das längst ein Problem. Wer Leistung immer noch mit Kontrolle und Anwesenheit verwechselt, verliert die Energie der Belegschaft – und den Anschluss im Wettbewerb um Talente.
Dann schauen Sie doch einmal in unser Dossier zum Thema. Dort stellen wir für Sie kontinuierlich Studien, Deep-Dives und Best Cases zusammen. Denn als wie attraktiv ein Unternehmen wahrgenommen wird, hängt maßgeblich von der Employer Brand ab. Erfahren Sie, wie Sie nach außen und innen zeigen, was Ihre Unternehmenskultur und Karrieremöglichkeiten einzigartig macht.
Was Arbeitgeber jetzt wirklich tun können
Arbeitgeberattraktivität entsteht nicht durch Durchhalteparolen, sondern durch Haltung. Wer verstanden hat, dass Menschen keine Maschinen sind, handelt entsprechend. Employer Branding heißt auch, zu verstehen, was Mitarbeitende benötigen – bevor sie ausbrennen, bevor ihr Job wegrationalisiert wird oder man sie mit 63 noch aufs Dach schickt.
Unternehmen sind dem politischen Wirrwarr nicht hilflos ausgeliefert. Sie können Impulse setzen und sollten das auch tun. Etwa durch flexible Übergänge statt pauschaler Verlängerungen. Durch smarte interne Stellenbesetzungen, neue Rollen für erfahrene Kräfte und durch den Willen, neue Perspektiven ins Unternehmen zu holen: von berufserfahrenen Müttern über Quereinsteiger bis zu Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Auch behinderte Menschen werden nach wie vor zu wenig einbezogen.
Arbeit lässt sich besser denken
Derzeit passiert das Gegenteil: Es wird mehr verlangt, ohne zu fragen, was eigentlich geleistet wird. Leistung wird gemessen, Wirkung kaum. Dabei ist die Frage so grundlegend wie einfach: Wollen wir mehr arbeiten? Oder wollen wir besser arbeiten?
Was wir benötigen, ist keine Pauschaldebatte, sondern eine ehrliche Diskussion darüber, wie unsere Arbeitswelt in Zukunft trotz aller Herausforderungen aussehen kann. Eine Arbeitswelt, die Unterschiede anerkennt, Belastungen berücksichtigt und mitdenkt, was Arbeit für uns als Gesellschaft eigentlich sein soll.
Vielleicht liegt die Zukunft der Arbeit nicht in der Stechuhr, sondern in der Fähigkeit, Menschen langfristig arbeitsfähig zu halten. Vielleicht brauchen wir nicht mehr Arbeit, sondern ein besseres Verständnis dafür, dass sich Arbeit in den vergangenen 50 Jahren grundlegend verändert hat – unsere Erwartungen daran aber kaum.
Wenn wir diesen Wandel anerkennen und Arbeit neu denken, haben wir eine Chance, sie wirksam zu gestalten. Für alle, die mittendrin sind. Und für die, die nachkommen.