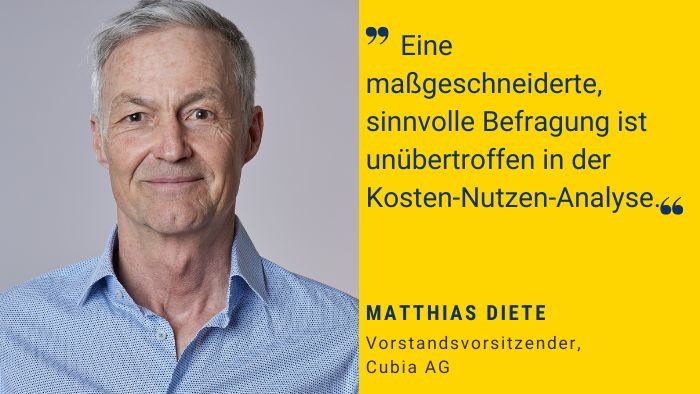Der Markt ist in Bewegung, das Tempo rasant. So berichten die Expertinnen und Experten des Round Table Mitarbeiterbefragung (MAB) der Personalwirtschaft. Um die schnellen parallel laufenden Veränderungen zu bewerkstelligen, müssen Arbeitgeber Mitarbeitende begleiten – und dafür natürlich auch wissen, wie es ihnen geht und welche Bedürfnisse sie haben. Matthias Diete, Vorstandsvorsitzender der Cubia AG – einer Unternehmensberatung für Feedbackprozesse –, beschreibt die herausfordernden Umstände am Markt seit dem Ende der Pandemie folgendermaßen: „Außenfaktoren, wie die globalen Krisen und die gestörten Lieferketten, beeinflussen das Geschäft unserer Kunden und den Anpassungs- oder Veränderungsdruck, den viele von ihnen wahrnehmen. Das hat bei vielen Kunden auch Auswirkungen auf die Schwerpunkte und Ziele einer MAB.“
Zuhören ist Trumpf
Einen Veränderungsdruck, und zwar „in einer noch höheren Frequenz, als wir das in der Vergangenheit kannten“, bemerkt auch Dr. Ingrid Feinstein, Director beim Marktforschungsunternehmen Ipsos GmbH. Darin besteht jedoch eine Chance – auch für die eigene Branche, wie sie meint: „Aufgrund der Unsicherheit, die wir gerade erleben, ist es noch wichtiger geworden, eine gute Datengrundlage für Businessentscheidungen bereitzustellen. Die Mitarbeitendenperspektive ist dabei eine ganz entscheidende Datenquelle.“
Als Senior Manager Employer Branding beim Hörgeräteanbeiter GEERS erlebt Beate Schulte den beschriebenen Wandel regelmäßig bei ihrer Arbeit: „Wir integrieren unsere Mitarbeitenden heute viel stärker als früher. Konzepte erstellen wir gemeinsam mit den Beschäftigten, weil sie aus HR-Sicht unsere Kundinnen und Kunden sind.“ Früher hingegen seien HR- und Personalentwicklungskonzepte – zumindest gefühlt – nicht bedarfsorientiert geschrieben worden.
Gen Z bringt eigene Themen mit
Bernd Neuwald, Managing Partner bei der CIP Corporate Intelligence Partners GmbH – einer Unternehmensberatung für Personalentwicklung –, beobachtet eine weitere Entwicklung. „Auf Projektebene herrscht ein Generationswechsel bei unseren Kunden. Die Generation Z kommt und bringt ihre eigenen Themen mit ein“, erläutert er. Dadurch verändere sich der Schwerpunkt bei der thematischen Zusammenstellung der Fragebögen. Neuwald präzisiert: „Was soll gefragt werden? In welchem Zusammenhang wird ein bestimmtes Item verwendet, und welchem Projekt soll es zugeführt werden? Welche Nachhaltigkeitsprojekte laufen im Unternehmen, und wie kann man diese mit der MAB verknüpfen?“ Mit dem Generationswechsel werde die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen verstärkt diskutiert.
Ein anderer Trend ist der technologische Wandel. „Vor allem deutsche Unternehmen erleben plötzlich technische Veränderungen, von denen sie glaubten, sie verliefen schneller oder kämen später“, beschreibt Neuwald. Als Beispiele nennt er den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), die Einführung bestimmter Tools und Technologien wie etwa generative und individuelle KI, zum Beispiel in Form eines Online-Portals des IT-Managements, oder der Einsatz von Natural Language Processing (NLP) in der Kundenbetreuung. Ein Beispiel hierfür wäre das Tool Brainpath. Weitermachen wie bisher? Fehlanzeige! Deshalb rät er seinen Kunden, nicht allein auf Prozessdenken zu setzen, sondern sich stattdessen zu fragen, welche Themen in drei Jahren wichtig werden. „Unsere Losung lautet: Machen, machen, machen. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“, fordert Neuwald.
Einfach verlockend oder verlockend einfach?
Im Zusammenhang mit dem technologischen Wandel darf ein Blick auf die Toolanbieter nicht fehlen, die den klassischen MAB-Anbietern gegenüberstehen. Sie wecken hohe Erwartungen bei den Unternehmen. „Viele potenzielle Kunden fragen uns zunächst nach unserem Tool. Denn die reinen Toolanbieter am Markt argumentieren häufig im Sinne von: Hier hast du dein Dashboard, da hast du eine Ampel. Die Farben Rot, Grün und Gelb zeigen dir, was zu tun ist. Das ist natürlich verlockend“, gibt Christian Motzko zu, Principal Director beim Beratungsunternehmen Accenture. In der Praxis sei das allerdings weniger einfach – denn letztlich müssten die Führungskräfte und Mitarbeitenden die Ergebnisse richtig, das heißt im Kontext des eigenen Arbeitsumfelds, einordnen können. Da reicht in der Regel nicht nur eine Ampeldarstellung. Er rät den Interessenten, sich nicht nur das Tool anzusehen, sondern stets zu prüfen, was hinter den Inhalten beziehungsweise dem Konzept der Befragung steht und wie handlungsorientiert die Ergebnisaufbereitung ist.
Motzko untermalt seine Empfehlung mit einem konkreten Beispiel: In einem Fall wurde die Situation im Unternehmen ausschließlich anhand des Employee Net Promoter Scores (Weiterempfehlungsbereitschaft, eNPS) beurteilt. Weitere Faktoren wurden nicht berücksichtigt. Alles, was zählte, war, wie diese Kennzahl zukünftig verbessert werden kann. „Die Toolfokussierung vieler Kunden lenkt davon ab, welche Inhalte wirklich zählen und was eine MAB leisten kann – und auch sollte. Die Erfahrung und auch das spezifische Know-how, das über die vergangenen 20 bis 30 Jahre im Bereich der Mitarbeitendenbefragungen gesammelt wurde, wird dabei häufig nicht genutzt“, gibt Motzko zu bedenken.
Apps als vermeintliche Problemlöser
Apps und Tools sind aber immer mehr Teil unseres Lebens und gerade für jüngere Menschen laut Diete von Cubia scheinbar ein schneller Problemlöser. Dabei seien sie lediglich ein Bestandteil der MAB. „Wir sehen Apps und andere IT-Prozesse bei der Organisationsentwicklung mittels Befragung als Werkzeuge und Teil der Lösung, nicht jedoch als die Lösung selbst“, sagt Diete. Er klärt in Kundengesprächen deshalb ab: „Ist ein Tool wirklich das Beste für euch? Ihr tut gut daran, mit Menschen zu sprechen, die langjährige Erfahrung mit dem Instrument MAB haben und viel mehr als nur Tools anbieten können.“
Auch Neuwald von CPI Corporate Intelligence Partners nimmt die Meinung vieler junger Menschen wahr, Organisationsentwicklung könne rein appgesteuert erfolgen. Doch diese Fehlannahme könne auch eine Chance für MAB-Beraterinnen und -Berater sein. Denn je mehr Tools es gibt, desto mehr Beratung sei auch nötig. „Als MAB-Expertinnen und -Experten beraten und begleiten wir den Prozess methodisch-inhaltlich. Mit den Tools eröffnet sich möglicherweise eine breiter werdende Nische für unseren Beratungsansatz“, so die Einschätzung von Neuwald.
Konkurrenz versus Ökosystem
Ingrid Feinstein von Ipsos zielt in eine ähnliche Richtung, wenn sie sagt: „Ich sehe die Tools nicht als unsere Konkurrenz, sondern nehme uns gemeinsam als Ökosystem wahr, in dem wir als Expertinnen und Experten noch viel stärker beratend tätig sein müssen. Darin liegt auch die Chance.“ Ein Tool sei erstmal vor allem ein Werkzeug. Aus ihrer Sicht gibt es keine Plattform, die alle Kundenwünsche erfüllt, sondern jede habe ihre Stärken und Schwächen. „Man muss wissen, wo der Kunde den Schwerpunkt in puncto Technologie legt. Dann kann man ihn dahingehend beraten, welche Plattform sich mehr oder weniger für ihn eignet. Unsere Stärke liegt ganz klar in der Beratung und Methodik. Das, was die Tools als gute Basis liefern, veredeln wir sozusagen durch unsere Beratung“, sagt Feinstein.
Aktives oder passives Zuhören?
Das Auswerten von E-Mails und anderen Texten per Passive Listening birgt Chancen und Risiken. Warum das Active Listening trotzdem unverzichtbar ist.
Chatverläufe, E-Mails und Kalendereinträge scannen, um so einen Eindruck der Mitarbeiterzufriedenheit zu bekommen – auch das ist eine Form der MAB. Beim sogenannten Passive Listening werden Metadaten, welche die Mitarbeitenden während ihrer Arbeit hinterlassen, anonym gesammelt und analysiert. Das Gegenstück ist Active Listening, bei dem HR-Expertinnen und -Experten Feedback per Umfragen einholen oder zusätzlich aktiv mit den Mitarbeitenden sprechen. Was bringt mehr? Die Expertinnen und Experten des Round Table sehen kein Entweder-oder. Vielmehr komme es auch hier auf den jeweiligen Fall an. Beate Schulte, Senior Manager Employer Branding bei GEERS, bezeichnet sich persönlich zwar als Dialogmensch, aber das Passive Listening und seine Einsatzmöglichkeiten faszinieren sie: „Es ist interessant, mit Passive Listening die Kulturmerkmale der Sprache herauszukitzeln, die die Beschäftigten in der Zusammenarbeit untereinander verwenden. Welcher Typ Mensch ist es vom Sprachstil her? Und wie spricht die Führungsebene?“
Sowohl-als-auch statt Entweder-oder
Beim Blick darauf, ob Active Listening oder Passive Listening mehr nütze, plädiert Schulte dafür, beide Formen miteinander zu verbinden. „Die Mischung machts. Ein eher introvertierter Mensch, der nicht aktiv im Dialog mitarbeitet, hat zum Beispiel über Passive Listening die Möglichkeit, seine Meinung in anonymer Form zu äußern“, führt sie aus. Bei anderen hingegen sei das persönliche Gespräch sehr hilfreich.
Matthias Diete, Vorstandsvorsitzender der Cubia AG, steht dem passiven Zuhören kritischer gegenüber: „Beim Passive Listening wird im Moment viel versprochen und wenig gehalten. Es muss immer wissenschaftlich und kritisch begleitet werden.“ Auf der anderen Seite sieht er Möglichkeiten und berichtet in diesem Zusammenhang von einem Projekt der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft, das sein Unternehmen seit vielen Jahren forschend begleitet. Dort untersucht Professor David Scheffer, welche Motivation Menschen antreibt, bestimmte Leistungen zu erbringen. Nach den Ergebnissen auf individueller Ebene stehe der nächste gemeinsame Schritt in dem Projekt an. Dann könne man beispielsweise Antworttexte, die während einer MAB in einer offenen Fragestellung gegeben wurden, „KI-gestützt auch dahingehend analysieren, welche motivationalen Faktoren in der Organisation generell überwiegen“, erläutert Diete. Dies wäre für die strategische Organisationsentwicklung hochinteressant.
Instrument der Wertschätzung
Christian Motzko, Principal Director bei der Accenture GmbH, stellt angesichts der Möglichkeiten durch das Passive Listening eine These auf: „Ich gehe davon aus, dass wir zukünftig rein aus Sicht der Informationsgenerierung möglicherweise keine klassische MAB mehr brauchen werden.“ Als Steuerungs- und Monitoringinstrument werde die MAB allerdings nur schwer zu ersetzen sein, denn sie biete die Möglichkeit, bestimmte Themen – die gegebenenfalls so gar nicht im Fokus stehen – gezielt zu adressieren. Schließlich sei die MAB auch ein wesentliches Instrument der Wertschätzung und helfe, Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden. Denn anders als das Passive Listening, von dem Mitarbeitende meist nach ihrer Einwilligung nicht viel mitbekommen, zeigt das Active Listening ihnen klar: Unser Arbeitgeber möchte unsere Meinung hören und mit uns in den Austausch gehen.
Dr. Ingrid Feinstein, Director bei der Ipsos GmbH, fügt hinzu: „Es geht bei der MAB vor allem auch darum, einen Impuls zu setzen, um zu bestimmten Themen in den Dialog zu treten und durch die Interaktion Veränderungen herbeizuführen.“ In diesem Fall sei Passive Listening fehl am Platz. „Wir wollen, dass die Mitarbeitenden auf den Impuls reagieren und Lösungen gemeinsam erarbeiten. Active Listening ist dann gefragt“, sagt sie.
Das sieht auch Motzko von Accenture so. Er hebt den positiven Effekt von persönlichen Gesprächen hervor, die Unternehmen in sogenannten Fokusgruppen mit mehreren Mitarbeitenden nach der eigentlichen MAB führen können. „Die Menschen fühlen sich besser abgeholt und eingebunden. Zudem können so die Feinheiten und Ursachen hinter den Ergebnissen aufgedeckt werden. Insofern hat Active Listening seinen Nutzen.“ Dennoch gibt er zu bedenken: „Fokusgruppen mit allen Mitarbeitenden zu machen, ist häufig nicht möglich. Entsprechend ist die MAB das einzige Instrument, mit dem ein repräsentatives und von den Daten her möglichst objektives Bild generiert werden kann.“
Dabei sollte nicht vergessen werden: Richtig zu kommunizieren will gelernt sein. Viele Führungskräfte hätten hier Nachholbedarf. Der Experte befürwortet zwar persönliche Gespräche, „aber es ist gefährlich, wenn eine Führungskraft diese Dialoge nicht sauber mit Mitarbeitenden führen kann. Dann geht manchmal mehr kaputt, als dass es hilft“. Diejenigen, die den Dialog führen, sollten mit entsprechender Kommunikationskompetenz ausgestattet werden.
Transparenz ist gefordert
Beim Passive Listening wiederum gibt es diese Gefahr nicht. Dafür andere: „Organisationen müssen sehr transparent darlegen, welche Fragestellung sie warum mit Passive Listening beantworten wollen“, sagt Feinstein. „Es braucht sehr klare Regeln. Ansonsten ist die Offenheit der Kommunikationskultur und generell das Vertrauen in die Organisation gefährdet.“
Bernd Neuwald, Managing Partner bei der CPI Corporate Intelligence Partners GmbH, arbeitet mit qualitativen Methoden und nutzt insbesondere persönliche Gespräche und Textanalyse. Zum Passive Listening greift er nur in definierten Fällen, und zwar, „wenn wir unternehmensschädigendem Verhalten nachgehen oder den Schriftverkehr in Coaching-Zusammenhängen auswerten“. Neuwald bezeichnet das passive Zuhören als hochinteressant, sieht aber Risiken. „Was macht Passive Listening mit den Beschäftigten? Sie werden ein bisschen zum Objekt und wissen nicht, ob eine Geheimwissenschaft damit verbunden ist“, sagt er und rät deshalb zur guten kommunikativen Begleitung. Die befragte oder analysierte Person müsse „weiterhin Subjekt bleiben“ – es sei denn, sie habe dem Unternehmen geschadet.
Diete von Cubia zieht ein Fazit: Das persönliche Gespräch sei „nicht zu toppen“. Es folgen das 360-Grad-Feedback, die MAB und das Passive Listening als Austauschformate mit den Mitarbeitenden. „Je nach Situation kann alles davon berechtigt und sinnvoll sein. Ich selbst bevorzuge die Formate, die nah am Menschen sind.“ Das sei aber ab einer gewissen Organisationsgröße aus Kapazitäts-, Zeit- und Kostengründen kaum möglich. Er resümiert: „Eine maßgeschneiderte, sinnvolle Befragung ist unübertroffen in der Kosten-Nutzen-Analyse.“
Wie kann die MAB ihre volle Wirkung entfalten?
Die vielfältigen Möglichkeiten bei der Mitarbeiterbefragung erfordern einen anderen Beratungsansatz von den Anbietern. Wie der aussieht und was das für den Folgeprozess bedeutet.
Unternehmen haben beim Instrument MAB die sprichwörtliche Qual der Wahl. Das hat Folgen, wie der Round Table zeigt. „Ich spüre bei Kontakten mit Unternehmen, dass die Vielfalt an Möglichkeiten sie verunsichert“, beobachtet Matthias Diete, Vorstandsvorsitzender der Cubia AG. So hinterfragen Kunden bestimmte Prozesse, die sie bisher regelmäßig durchgeführt haben. Sie schauen darauf, welche anderen Möglichkeiten es gibt und was der Wettbewerb macht. Dadurch stehen MAB-Berater und -Beraterinnen „noch mehr als früher vor der Herausforderung, das richtige Instrument für den jeweiligen Kunden zu definieren“. Denn fest steht: Das eine perfekte Instrument für alle gibt es nicht.
Vom Kundenbedarf ausgehen
Um sich folglich nicht in der Landschaft der MAB-Instrumente zu verlieren, ist laut Diete die Zieldefinition noch wichtiger geworden. Man sollte nicht überlegen, was man mit einem bestimmten MAB-Instrument erreichen kann, sondern „Ausgangspunkt ist die Frage, wo die Organisation steht, wohin sie gehen will und wo die Probleme liegen“. Doch das ist leichter gesagt als getan. „Selbst die Verantwortlichen des Unternehmens sind sich darin nicht immer einig“, erlebt er.
Dr. Ingrid Feinstein, Director bei der Ipsos GmbH, sieht die Dienstleister gefordert: „Anstelle vom Instrument ausgehend zu beraten, müssen wir verstärkt schauen, welchen Bedarf der Kunde hat und welche Fragestellungen beantwortet werden müssen.“ Welches Problem hat das Unternehmen? Geht es um Engagement und Produktivität oder um Arbeitgeberattraktivität und Bindung? „Davon ausgehend, können wir dabei beraten, welche Instrumente am besten helfen, diese Ziele zu unterstützen, und wie häufig sie eingesetzt werden sollten.“
Blick auf die Ressourcen
Diete von Cubia ergänzt, dass auch die Frage der zur Verfügung stehenden Ressourcen vor der Entscheidung für eine MAB-Form geklärt werden müsse – das gelte für die Befragung und die Abläufe danach, auch bezeichnet als Folgeprozess. Sie erfordern teilweise viel Zeit, Geld, Manpower, Know-how und die Bereitschaft im Unternehmen, Veränderungen anzustoßen. Deshalb sei es wichtig, vorab folgende Frage zu beantworten: Wo steht die Organisation mit ihren Möglichkeiten und Erwartungen? „Nur wenn wir ein Gesamtbild haben, können wir bestimmte Instrumente empfehlen. Das gilt heute viel stärker als früher“, erläutert er. Sind die Ressourcen für die Folgeprozesse zu knapp, sei es sinnvoll, ein Konzept zu erstellen, wo das Unternehmen Schwerpunkte setzen möchte.
Benötigen Unternehmen ein Mehr an Beratung zum Thema Folgeprozess im Vergleich zu früher? „Unser Unternehmen ist gut ausgestattet im Bereich HR, also haben wir hier keinen Beratungsbedarf“, sagt Beate Schulte, Senior Manager Employer Branding bei GEERS. Außerdem führe man den Folgeprozess lieber hausintern durch, „weil wir da viel lernen können und noch mal in den Dialog mit den Mitarbeitenden treten“. Sie geht aber davon aus, dass viele Unternehmen angesichts der personellen Engpässe im HR-Bereich Beratungsbedarf für den Folgeprozess haben, je nach ihrer Größe und Unternehmenskultur.
Info
Das Wichtigste in Kürze
- Angesichts der vielfältigen MAB-Möglichkeiten sollten Anbieter zunächst Problem und Ziel der Organisation herausarbeiten und darauf basierend das Instrument empfehlen.
- Unternehmen haben den Anspruch, positive Effekte aus einer MAB zu erzielen und messen Beratungen zunehmend daran. MAB-Anbietende müssen also mehr können als eine Befragung sauber umzusetzen.
- MAB-Consultants können die Toolanbieter als Chance sehen, ihre Beratung noch stärker einzubringen im Sinne eines Ökosystems.
- Beim Active Listening und Passive Listening gibt es kein Entweder-oder. Beide Methoden lassen sich miteinander kombinieren.
- Wer Passive Listening im Unternehmen einsetzt, sollte sehr transparent darlegen, welche Fragen damit warum beantwortet werden sollen.
Messlatte Folgeprozess und positive Effekte
So oder so scheint der Folgeprozess immer wichtiger zu werden. Christian Motzko, Principal Director bei der Accenture GmbH, hat einen Wandel in der Erwartungshaltung der Unternehmen bemerkt: „Unsere Kunden haben den Anspruch, positive Effekte aus der MAB zu erzielen, und messen uns Berater zunehmend daran. Das war früher anders“, erläutert er. Der Bedarf der Kunden kann also nur dann durch den Anbieter gedeckt werden, wenn dieser mehr vermag, als nur eine Befragung sauber umzusetzen.“
Employer-Branding-Expertin Schulte bestätigt, dass die Erwartung an eine MAB und den Folgeprozess auf Unternehmensseite sehr hoch ist. Sie betont, wie wichtig es ist, nach der Auswertung der Befragung in den Dialog mit den Beschäftigten zu gehen: „Ich brauche nicht nur die Daten und den eNPS (Employee Net Promoter Score, Anm. d. Red.), sondern muss danach in den Dialog mit Mitarbeitenden und Führungskräften treten.“ Ihrer Erfahrung nach setzen Unternehmen die Folgeprozesse sehr unterschiedlich um. Hat zum Beispiel der Personalvorstand auf globaler Ebene Beteiligungsquoten für die einzelnen Länder definiert, werde „stark darauf geachtet, dass die Maßnahmen nach der MAB für alle transparent vollzogen werden.“ Dabei ist es wichtig, klar zu kommunizieren, was jede Führungskraft plant, und ob Gespräche oder Workshops und damit Interpretationen der MAB-Ergebnisse stattgefunden haben. Auf der anderen Seite gebe es kleinere Unternehmen, die eine MAB laut Schulte „etwas hemdsärmeliger umsetzen“.
Bernd Neuwald, Managing Partner bei der CPI Corporate Intelligence Partners GmbH, vergleicht ein Unternehmen mit einem Mobile, das man per MAB antickt und in Bewegung bringt. „Mit welchen Inhalten berühren wir es, und wie sollen diese Inhalte in einem geordneten Anschlussprozess miteinander harmonieren?“, beschreibt er und empfiehlt, jeden Auftrag vorab sorgfältig zu klären. „Eine systemische, umfassende Perspektive über den Gesamtprozess ist ein wichtiger Punkt, den man mit dem Kunden möglichst gut abklären soll.“ Dazu gehören auch ungeplante Szenarien, die den Anschlussprozess negativ beeinflussen könnten. Was passiert beispielsweise, wenn plötzlich nur noch 40 Prozent der Ressourcen zur Verfügung stehen? Oder welchen Einfluss hätte ein Vorstandswechsel?
Wandel der Feedbackkultur
Die Qualität der MAB und des Folgeprozesses steht und fällt allerdings mit der Feedbackkultur in der Organisation. Wichtig ist eine gute Vertrauensbasis, insbesondere in unserer zunehmend komplexen Welt voll schneller Veränderungen. Feinstein von Ipsos rät Unternehmen, viel agiler zu werden: „Sie brauchen eine Feedbackkultur, die es erlaubt, sehr schnell auf Impulse zu reagieren. Das gilt auf allen Ebenen einer Organisation.“ Bernd Neuwald nimmt wahr, dass wir uns in der Arbeitswelt generell mehr Feedback geben als noch vor ein paar Jahren. Das sei vor allem durch das sich weiterhin verbreitende agile Arbeiten geschehen. Denn in agilen Kulturen, beispielsweise der IT-Branche, seien häufig stattfindende kurze, orientierungsgebende Meetings und Retrospektiven als Feedback- und Austauschformate Teil des Steuerungsprozesses und somit an der Tagesordnung.