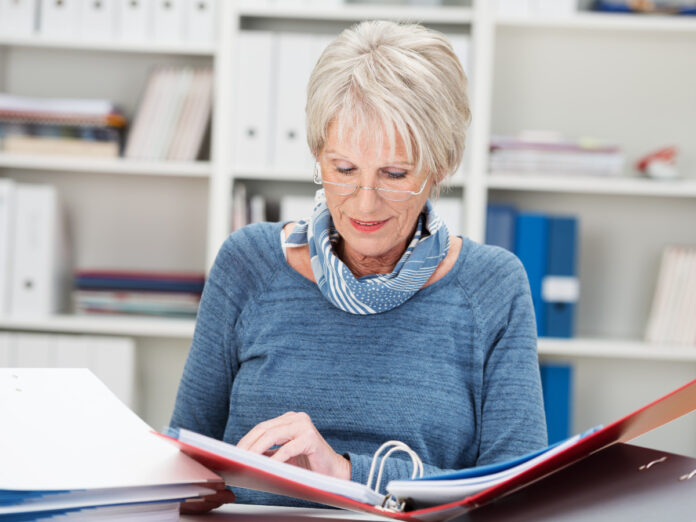Deutschland wird immer älter, mit teils dramatischen Folgen für den Arbeitsmarkt. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung wird in der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen die Zahl der potenziell Erwerbstätigen bis 2040 um etwa 1,6 Millionen Menschen zurückgehen (minus 7,7 Prozent). In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen schrumpft die Zahl sogar um 3,2 Millionen (minus 13,3 Prozent). Auch die Zuwanderung aus dem Ausland sei nicht ausreichend, um die Zahl der Menschen im Erwerbsalter ausreichend anzuheben, hat das Statistische Bundesamt bereits im September 2023 ermittelt. Insbesondere in Ostdeutschland ist die Entwicklung dramatisch.
Beispiel Mecklenburg-Vorpommern: Noch 2020 betrug der Anteil der Personen im Alter ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung knapp 25,8 Prozent. 20 Jahre später werden es 33 Prozent sein. Der Rückgang liegt damit doppelt so hoch wie im Durchschnitt des gesamten Bundesgebietes.
Den Grund für den Rückgang liegt laut Statistischem Bundesamt vor allem in der gegenwärtigen Altersstruktur in den östlichen Bundesländern: Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 sei die Zahl der Geburten eingebrochen, zudem seien verhältnismäßig viele Menschen in den vergangenen Jahrzehnten ausgewandert. Bettina Sommer, Bundesamt-Expertin für Bevölkerungsentwicklung erläutert: „Selbst bei vergleichsweise hoher Zuwanderung, wie wir sie aktuell beobachten, können die damit verbundenen Verluste im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Bevölkerung im Erwerbsalter nicht kompensiert werden.“
Die Bevölkerung wächst und altert
Bezeichnenderweise wächst die deutsche Bevölkerung bis 2040 sogar. Laut der Bertelsmann-Prognose werden dann 83,67 Millionen Menschen in Deutschland leben, plus 0,6 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. In absoluten Zahlen werde die Bundesrepublik in den nächsten 16 Jahren um etwa eine halbe Million Einwohner wachsen.
Dabei gibt es auch hier ein enormes Ost-West-Gefälle. Während Sachsen-Anhalt (minus 12,3 Prozent) und Thüringen (minus 10,9 Prozent) stark verlieren, müssen sich die Stadtstaaten Berlin und Hamburg mit 5,8 und 3,5 Prozent sowie die Flächenländer Baden-Württemberg und Bayern mit 4,6 und 4,4 Prozent auf große Zuwächse einstellen.
Ost-West-Gefälle besteht nach wie vor
Entsprechend dieser Entwicklung sind die Unternehmen im Osten auch stärker vom Fachkräftemangel betroffen, wie die neueste Ausgabe der „Ifo-Konjunkturperspektiven“ vom März dieses Jahres vermeldet. 42,1 Prozent der ostdeutschen Unternehmen gaben an, dass fehlendes Fachpersonal ihre Geschäfte beeinträchtigt. Für ganz Deutschland lag der Wert bei 36,3 Prozent. Am deutlichsten fiel der Unterschied im verarbeitenden Gewerbe aus. Dort lag der Anteil der vom Fachkräftemangel beeinträchtigten Unternehmen in Ostdeutschland im ersten Quartal 2024 mehr als 16 Prozentpunkte über dem gesamtdeutschen Schnitt.
Im Dienstleistungssektor und im Handel betrug die Differenz 5,9 beziehungsweise 2,6 Prozentpunkte. Lediglich im Bauhauptgewerbe zeigten sich die Befragten im Osten zuletzt weniger betroffen als in Gesamtdeutschland, heißt es in dem Bericht.
Höhere Nachfrage trifft auf sinkende Bewerberzahlen
Für den Unterschied sind laut ifo vor allem zwei Effekte verantwortlich: Die befragten Unternehmen äußerten sich im Osten sowohl bezüglich ihrer Geschäftslage als auch ihrer Erwartungen zuversichtlicher als im bundesweiten Vergleich: Die stärkere Konjunktur führt zu einer höheren Nachfrage nach Arbeitskräften. Andererseits geht das Arbeitskräfteangebot in Ostdeutschland schneller zurück als im übrigen Teil der Republik. „Der demografische Wandel auf den Arbeitsmärkten im Osten macht sich bereits seit Jahren deutlich stärker bemerkbar“, erläutert Ernst Glöckner von der Dresdner Niederlassung des ifo-Instituts.
Der Abstand zwischen ostdeutschen und bundesweiten Ergebnissen hat sich in den vergangenen Jahren im Übrigen deutlich vergrößert. Während der Personalmangel im dritten Quartal 2022 in Ost und West gleichermaßen seinen Höchststand erreichte (etwa die Hälfte aller Unternehmen gab jeweils an, unter Engpässen zu leiden), ist der Anteil der Betroffenen in ostdeutschen Unternehmen seitdem deutlich weniger stark zurückgegangen als im bundesweiten Vergleich. Während in Ostdeutschland Anfang 2024 immer noch 42,1 Prozent aller Unternehmen über mangelndes Personal klagten, waren es im Westen nur noch 36,3 Prozent, hat das ifo-Institut ermittelt.
Info
DAK-Pflegereport: Düstere Aussichten
Das Ausscheiden der Baby-Boomer-Generation verschärft die Situation der beruflichen Pflege in Deutschland massiv. Neben erheblichen Finanzierungslücken in der Pflegeversicherung bedroht die steigende Personalnot zunehmend die Versorgung pflegebedürftiger Menschen. Das sind Ergebnisse des aktuellen Pflegereports der DAK-Gesundheit, für den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Thomas Klie vom Institut AGP Sozialforschung die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf das Pflegesystem untersucht haben.
Demnach wird die ohnehin dünne Arbeitsmarktreserve von rund 11.750 Fachkräften (2,0 Prozent) in 2025 auf lediglich 5.600 Fachkräfte (0,5 Prozent) bundesweit im Jahr 2030 abschmelzen. Laut Pflegereport müssen in den nächsten zehn Jahren fast in jedem Bundesland 20 Prozent Pflegepersonal ersetzt werden.
Mit Offenheit gegen Fachkräftemangel
Doch wie umgehen mit dem Wandel beziehungsweise dem Mangel? Wie können (ostdeutsche) Unternehmen darauf reagieren, dass sie trotz voller Auftragsbücher wirtschaftlich auf der Stelle treten, weil sie nicht die richtigen Mitarbeitenden finden? Für HR-Influencer Toygar Cynar liegt die Lösung in einer verstärkten Zuwanderung. „Der Osten Deutschlands kämpft mit einem Fachkräftemangel. Die Lösung? Ein weltoffenes Deutschland, das ausländische Fachkräfte nicht nur braucht, sondern auch willkommen heißt“, schreibt Cynar auf Linkedin. „Vielleicht ist der Fachkräftemangel die Chance, Rassismus aus den Köpfen zu kriegen und Offenheit zu lernen“, hofft er sogar.
Hier aber liegt die Krux, glaubt das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (iwd): Nur gut ein Drittel der Ausländer in Ostdeutschland habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Im Gegensatz zum Rest des Landes, wo in acht (westdeutschen) Bundesländern mehr als die Hälfte aller Zuwanderer unbefristet bleiben darf, mit unmittelbaren Folgen für den Fachkräftemangel. Das hat zwar nichts mit Rassismus zu tun, wohl aber mit Vorbehalten gegenüber den beruflichen Fähigkeiten der Zuwanderer.
Generell gehe es in den kommenden Jahren darum, ein Klima zu schaffen, in dem sich Zuwanderer willkommen fühlen – speziell in den ostdeutschen Bundesländern. „Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für Politik, Unternehmen und Gesellschaft gleichermaßen. Die Ansiedlung von Großunternehmen ist dabei als Chance zu sehen, dass ausländische Fachkräfte sich vermehrt in Ostdeutschland niederlassen“, analysiert das iwd und hat dabei offenbar auch den Elektroauto-Giganten Tesla mit seiner Gigafactory in Brandenburg im Blick. Der zeigt in Sachen Personalgewinnung im Übrigen größtmögliche Offenheit: „Wir stellen in verschiedenen Bereichen für unterschiedlichste Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen ein – Erfahrung in der Automobilindustrie ist nicht erforderlich“, schreibt das Unternehmen auf seiner Recruiting-Webseite.
Offenheit fordert das iwd auch beim Thema Inklusion: „Wenn es um Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung geht, wird in der Öffentlichkeit oft über Arbeitskräfte aus dem Ausland diskutiert. Um Inklusion geht es eher selten“, kritisiert das Institut. Dabei schlummere hier großes Potenzial: Bundesweit gab es laut IW im Jahr 2021 rund 3,1 Millionen Schwerbehinderte im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre). Von ihnen sind längst nicht alle in den Arbeitsmarkt integriert. So waren im Oktober 2023 rund 166.000 Menschen mit Behinderungen arbeitslos – trotz guter Qualifikation.
Im Jahr 2022 hatten 54 Prozent der arbeitslosen Menschen mit Behinderungen einen Berufs- oder Hochschulabschluss. Bei den Arbeitslosen ohne Behinderungen waren es nur 43 Prozent. Potenzial, das es auch im Osten der Republik zu heben gilt.
Sven Frost betreut das Thema HR-Tech, zu dem unter anderem die Bereiche Digitalisierung, HR-Software, Zeit und Zutritt, SAP und Outsourcing gehören. Zudem schreibt er über Arbeitsrecht und Regulatorik und verantwortet die redaktionelle Planung verschiedener Sonderpublikationen der Personalwirtschaft.