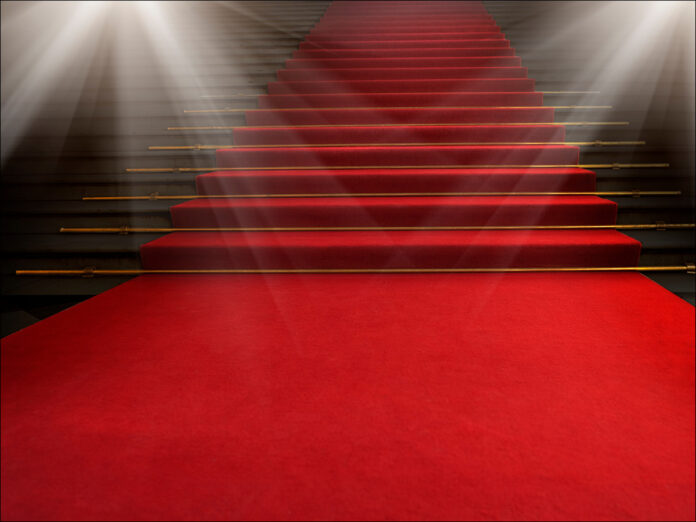Am 6. Juni 2023 ist die europäische Entgelttransparenzrichtlinie (EU/2023/970) in Kraft getreten. Für Unternehmen bedeutet das: Sie sind verpflichtet, für mehr Lohntransparenz zu sorgen und müssen ab 2026 das geschlechtsspezifische Lohngefälle offenlegen. Schon jetzt können sich Arbeitgeber für Entgeltgleichheit beziehungsweise keine signifikanten Abweichungen im Gesamtvergütungspaket von Frauen und Männern zertifizieren lassen.
Das Deutsche Institut für Qualitätsstandards und -prüfung (DIQP) geht aktuell von mehr als 500 Arbeitgebersiegeln in Deutschland aus. Unternehmen können sich zum Beispiel die hohen Qualitätsstandards ihrer Arbeitszeitmodelle, Ausbildung, Gesundheitsmaßnahmen oder Nachhaltigkeitsbemühungen bestätigen lassen – und nun auch die Entgeltgleichheit im Betrieb. Manche der diversen Siegel, so heißt es selbstkritisch in der Branche, werden von den Zertifikatsverleihern schon nach dem Lesen der Selbstverpflichtung der Unternehmen vergeben; andere Vergabestellen prüfen dagegen Daten, Fakten und Zahlen, die sie selbst erheben oder die ihnen der Arbeitgeber zur Verfügung stellt.
Ob der Plan aufgeht, Bewerbende von einer bestimmten Unternehmenseigenschaft so nachdrücklich zu überzeugen, dass sie sich für einen prämierten Arbeitgeber entscheiden, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Studien der Gütesiegelverleiher belegen die positive Wirkung mit eigenen Zahlen; gleichzeitig ergeben andere Untersuchungen, dass Kandidatinnen und Kandidaten die Prämierung von Arbeitgebern häufig nicht als vertrauenswürdig erscheint. Zum einen, weil angehende Professionals zwischen der Masse der Zertifikate nicht mehr unterscheiden können; zum anderen, weil die zugrunde liegenden Bewertungsverfahren nicht transparent sind. Auch Arbeitgeber schauen bei der Expansion der Arbeitgeber-Awards viel genauer hin: Wollen sie mit einer Zertifizierung in erster Linie ihre Employer Brand und ihr Recruiting unterstützen? Dann spielt die Art der Erhebung eher eine untergeordnete Rolle. Oder möchten sie in erster Linie ihre HR-Aktivitäten wie etwa Arbeitszeitmodelle oder Aufstiegschancen evaluieren lassen, um Baustellen zu identifizieren, sich mit Mitbewerbern zu messen oder State of the Art zu sein? In diesen Fällen prüfen sie die Methoden der Auditierung sehr genau.
Lohngefälle auf dem Prüfstand
Entgelttransparenz im Unternehmen ist – anders als zum Beispiel Fahrradfreundlichkeit oder Kinderbetreuung während der Arbeitszeit – kein „nice-to-have“, sondern ab 2026 gesetzliche Pflicht. Während sich Fahrradfreundlichkeit einfach durch das Zählen beispielsweise von E-Bikes und Ladestationen nachweisen lässt und Kinderbetreuung durch das Ausrechnen der vorhandenen Plätze sowie die Nennung großzügiger Öffnungszeiten, ist der Beweis der Lohngleichheit von Frau und Mann ungleich schwieriger zu erbringen. Für die Mehrzahl der Arbeitgeber ist die Aufgabe noch Neuland. Daher befassen sich etliche bereits jetzt damit, obwohl sie sich theoretisch noch Zeit lassen könnten: Der Gesetzgeber muss die Richtlinie erst bis 2026 in nationales Gesetz umsetzen. Was aber schon heute feststeht: Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten sind r verpflichtet, jährlich über ihr Lohngefälle zu berichten. Nach jetzigem Stand sollen Betriebe ab 150 Beschäftigten alle drei Jahre berichten.
Großunternehmen gehen, wie häufig, zeitnah mit gutem Beispiel voran und lassen ihre Entgeltsysteme auditieren. So hat die BMW AG im März 2023 als erstes Unternehmen in Deutschland die höchste Zertifizierung des Fair Pay Innovation Lab (FPI) erreicht. Die Auszeichnung belegt, dass die Vergütungsstrukturen im Unternehmen fair gestaltet sind und es keine signifikanten Abweichungen im Gesamtvergütungspaket von Frauen und Männern gibt.
Equal-Pay-Gütesiegel national und international
Bei der Vielzahl der Arbeitgeber-Awards erstaunt auf den ersten Blick, dass bislang nur eine gute Handvoll Equal-Pay-Zertifikate national und international zu finden ist. Einerseits liegt die Ursache in der bis vor Kurzem noch fehlenden gesetzlichen Notwendigkeit. Lohntransparenz war lange nur ein Schlagwort, und Entgeltgleichheit von Frau und Mann gehörte ins Reich der Träume.
Andererseits ist offensichtlich: Auch potenzielle Zertifizierer müssen für den Untersuchungsgegenstand Lohngerechtigkeit zunächst Methoden und Prozesse zur Bewertung entwickeln sowie im besten Fall mit Vergütungsexpertinnen und -experten kooperieren, die auf die Komplexität von Stellenbewertungsverfahren spezialisiert sind. Umso wichtiger ist es, genau hinzuschauen, welche Auditierungen aktuell zum Einsatz kommen und aufgrund welcher Daten das Gütesiegel verliehen wird.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht (alphabetisch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
German Equal Pay Award
Der German Equal Pay Award ist Teil eines Unternehmensprogramms des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) mit dem Titel „Entgeltgleichheit fördern. Unternehmen beraten, begleiten, stärken“ (www.entgeltgleichheit-fördern.de). Der Award wurde im Jahr 2023 bereits das zweite Mal verliehen; insgesamt erhielten bisher zwölf Unternehmen die Auszeichnung.
Methodik: Auf der Website des BMFSFJ heißt es dazu: „Die Jury entscheidet, welche innovativen, wirksamen und vielversprechenden Konzepte am meisten zur Entgeltgleichheit in Unternehmen beitragen. Die Unternehmen werden dann vom BMFSFJ mit dem German Equal Pay Award ausgezeichnet.“ Mitglieder der Jury sind acht Expertinnen und Experten, darunter Prof. Dr. Miriam Beblo von der Universität Hamburg, Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager (BPM), und Evelyne de Gruyter, Geschäftsführerin des Verbands der Unternehmerinnen. Zu den Prüfinstrumenten, also ob eine Entgeltanalyse und ein Bewertungsprozess erfolgen oder wie die Unternehmenskonzepte gewichtet werden, gibt es keine weiteren Angaben.
Kosten: Die Teilnahme ist auch bei der kommenden Ausschreibung des German Equal Pay Awards kostenfrei.
Edge Certification® – The Certification for Workplace
Die 2009 gegründete Edge Certified Foundation mit Sitz in der Schweiz konzentriert sich auf die Auditierung und Zertifizierung von Diversity, Equity and Inclusion (DE&I).
Methode: Die Edge Certified Foundation arbeitet mit drei international zugelassenen Zertifizierungsstellen (Flocert, Intertek, SGS) zusammen, die Audits und Zertifizierungsprozesse auf Basis der Edge Global Standards durchführen. Mehr als 250 große Organisationen in 57 Ländern haben die Edge-Zertifizierung auf einer der drei erreichbaren Auszeichnungen erhalten.
Kosten: Keine Angaben auf der Website.
Equal Salary Certification – Equal Salary Foundation
Die schweizerische Equal Salary Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Stiftung. Das 2005 in Zusammenarbeit mit der Universität Genf entwickelte Equal-Salary-Label wurde vom Bundesamt für Gleichstellung finanziell gefördert.
Methodik: Die Gehaltsanalysen nimmt PwC Schweiz vor. Wenn das bewerbende Unternehmen ein überzeugendes Ergebnis erzielt (Gesamtgehaltslücke unter fünf Prozent), stellt eine zweite qualitative Auditphase sicher „(…), dass das Unternehmen konkrete Instrumente einsetzt, um geschlechtsspezifische Verzerrungen hervorzuheben und zu vermeiden, sei es bei Gehaltserhöhungen, beim beruflichen Aufstieg oder jedem anderen mit der Gleichstellung von Frauen und Männern verbundenen Bereich“.
Kosten: Die Kosten der Zertifizierung hängen von der Größe der Organisation (Anzahl der Mitarbeiter und Anzahl der Standorte) ab. Diese umfassen die Zertifizierungsgebühren, die Gehaltsanalyse und die Vor-Ort-Audits. Die Equal-Salary-Zertifizierung ist drei Jahre lang gültig. Während dieser Zeit werden in den zertifizierten Unternehmen zwei Kontroll-Audits durchgeführt.
Fair Compensation – Great Place to Work® Institut
Great Place to Work® mit Sitz in Köln ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Organisationen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Das Zertifikat Fair Compensation zeichnet objektive Lohngerechtigkeit aus.
Methode: Die Methode baut auf dem vom BFSFJ empfohlenen Verfahren Logib auf und wird stufenweise um zusätzliche Komponenten erweitert. Die auf Compensation spezialisierte Unternehmensberatung Dr. Vogt Consulting führt die Auditverfahren durch und erstellt einen Bericht. Dieser wird von der Association of Compensation und Benefits Experts (acbe) begutachtet. Die acbe soll in den nächsten Wochen vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt werden. Ein Expertengremium, das aktuell zusammengestellt wird, überprüft den Auditbericht und spricht eine Empfehlung für eine Zertifizierungsstufe aus. Nach einem Review durch Great Place to Work kann, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, das Zertifikat erstellt werden.
Zertifikate: Auszeichnungen können in folgenden Stufen erworben werden: „Fair Compensation“ (Lohngleichheit nach Geschlecht gemäß Logib-Regression), „Good practice“ (Lohngleichheit nach Geschlecht, Alter und Nationalität, differenziert für die Funktionen im Unternehmen) und „Excellence in Fair Compensation“ (Lohngleichheit nach Geschlecht, Alter und Nationalität gemäß Entgeltregelungen und Prozessen).
Kosten: Keine Angaben auf der Website. Die Zertifizierung hat eine Laufzeit von drei Jahren. Sie ist ein Jahr gültig und kann im Jahr zwei und drei durch ein Aufrechterhaltungsaudit um jeweils ein weiteres Jahr verlängert werden.
Universal Fair Pay Zertifikat – Fair Pay Innovation Lab
Das gemeinnützige Berliner FPI Fair Pay Innovation Lab (FPI gGmbH) zertifiziert seit 2021 Unternehmen weltweit – unabhängig von Größe und Branche. Die Auszeichnung steht unter der Schirmherrschaft des Bundesarbeitsministeriums. Der Universal Fair Pay Check® ist beim Europäischen Markenamt als Gewährleistungsmarke eingetragen. Diese garantiert den Unternehmen die Qualität der Zertifizierung.
Methodik: Jede Zertifizierung beginnt mit einer Analyse des bestehenden Gehaltsgefüges. Unternehmen können die Analyse
- eigenständig,
- mithilfe einer unabhängigen und vom FPI vorher
geprüften Analysesoftware oder - mit Unterstützung einer Vergütungsberatung, die vorher vom FPI geprüft wurde und als Partner gelistet ist vornehmen.
Im nächsten Schritt übermittelt das auditierte Unternehmen dem FPI Lab seine Analyseergebnisse. Ein Zertifizierungsgremium – das FPI Screening Board – entscheidet über die Einstufung. Das Gremium ist mit Vergütungsexpertinnen und -experten aus Deutschland, UK und Island besetzt, wobei diese alle zwei Jahre neu bestimmt werden.
Zertifikate: Unternehmen, die ihre Entgeltstrukturen darauf untersuchen, ob die Beschäftigten für gleiche und gleichwertige Tätigkeiten auch gleich entlohnt werden, können sich als „Fair Pay Analyst“ auszeichnen lassen. Diejenigen, die vorhandene Lohnlücken schließen, werden als „Fair Pay Developer“ bezeichnet. Das Zertifikat „Fair Pay Leader“ erhalten Unternehmen, die sämtliche Pay Gaps schließen konnten. Die zu erfüllenden Voraussetzungen sind transparent über die Markensatzung online verfügbar.
Kosten: Das FPI schlüsselt die Zertifizierungsgebühren transparent auf. So liegen sie zum Beispiel für Unternehmen mit 250 bis 499 Mitarbeitenden bei 1250 Euro. Hinzukommen kommen – sofern Unternehmen die Daten nicht selbst erheben – die Kosten für die zu erhebende Analyse der Entgeltdaten. Rund 20 Unternehmen jeder Größenordnung haben sich seit 2021 zertifizieren lassen.
Resümee
In dem noch jungen Markt der Equal-Pay-Zertifizierer zeigen sich deutliche Unterschiede vor allem im Bereich der Audits. Beim BMFSFJ werden lediglich Konzepte geprüft, die zur Lohngleichheit beitragen. Alle anderen Anbieter ermitteln passend zur angestrebten Zertifizierungsstufe das konkrete Lohngefälle zwischen Frau und Mann. Fast alle arbeiten mit festgelegten externen Auditierungsstellen und lassen dem Kunden keine Wahl. Nicht jedoch das FPI, das auch eine unternehmensinterne Prüfung der Entgeltstrukturen auf Lohngleichheit zulässt. So können bewerbende Unternehmen eine Analysesoftware einsetzen, die vorher vom FPI auf Umfang und Qualität geprüft wurde. Ebenso haben sie die Möglichkeit, sich von einer der Vergütungsberatungen mit viel Analyseerfahrung und Prüfroutine auditieren zu lassen, die zum Kreis der FPI-Partner zählen, da sie die Kriterien für den Universal Fair Pay Check erfüllen.
Man braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um vorherzusagen, dass im Jahr 2024 und 2025 weitere Arbeitgebersiegel auf den Markt kommen werden, die Unternehmen für ihre Fair-Pay-Politik auszeichnen möchten.
Christiane Siemann ist freie Wirtschaftsjournalistin und insbesondere spezialisiert auf die Themen Comp & Ben, bAV, Arbeitsrecht, Arbeitsmarktpolitik und Personalentwicklung/Karriere. Sie begleitet einige Round-Table-Gespräche der Personalwirtschaft.