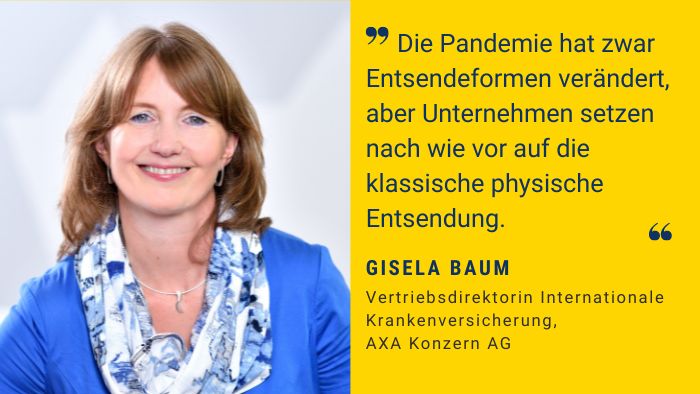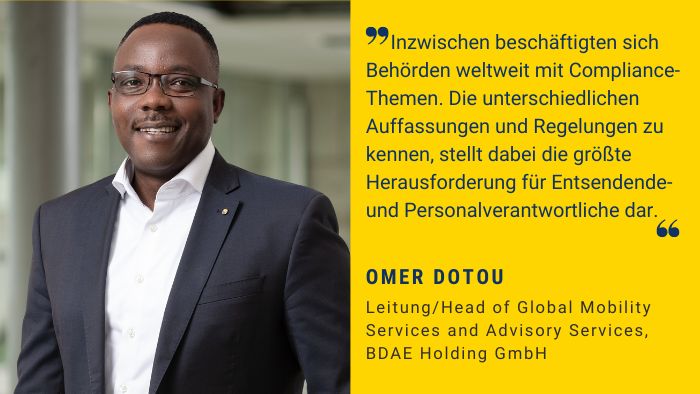Weltweit tätige Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre internationalen Geschäftsbeziehungen und ihre Entsendepolitik permanent den weltweiten (wirtschafts-)politischen Entwicklungen anzupassen. Im vergangenen Jahrzehnt musste das Global-Mobility-Management zum Beispiel auf Wirtschaftsembargos, abgeschottete Handelspolitik, den Brexit und die Krisenherde in Ägypten, Libyen und Syrien reagieren. Dann unterbrach im Jahr 2020 die Corona-Pandemie internationale Handelswege, Entsendungen waren für einige Zeit nur erschwert möglich oder mussten vorübergehend aufgeschoben werden. Seit zwei Jahren überstrahlt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die internationalen handelspolitischen Beziehungen – und die jüngsten kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten verstärken weltweit die Unsicherheit. Für die Entsendepolitik bedeutet das: Unternehmen, die zum Beispiel ihre Produktionsstätten sichern wollen, stellen sich darauf ein, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit einigen Ländern neu zu organisieren. Außerdem wägen sie ab, ob Investitionen in Europa und Nahost noch sicher sind und verstärken je nach Branche die Suche nach neuen Märkten, wie Omer Dotou, Leiter Global Mobility Services and Advisory Services von BDAE, berichtet. „Für fast alle Organisationen gilt: Vor dem Hintergrund der Konflikte werden die Fragen nach der passenden Entsendungsform und den Unterstützungsmaßnahmen in Form eines professionellen Relocation Supports noch relevanter“, ergänzt Giovanni De Carlo, Business Development Director EMEA von Crown World Mobility. „Viele Arbeitgeber diskutieren, wie sie ihre Entsendestrategie und -richtlinien ausrichten, und sie überlegen sich neu, an welchen Standorten sie Fachkräfte benötigen und wie sie deren erfolgreiche Entsendung organisieren können.“
Fürsorgepflicht in Kriegs- und Krisenregionen
Schon seit 2014 gilt die Ukraine als Krisengebiet, sodass Arbeitgeber verschiedene Vorkehrungen trafen, um der Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitenden vor Ort nachzukommen. Mit Kriegsbeginn erhöhten Unternehmen ihre Sicherheitsmaßnahmen: „Entweder holten sie ihre Beschäftigten zurück, oder sie informierten sich vermehrt über den Versicherungsschutz in der Kriegsregion“, erläutert Gisela Baum von AXA, die auf internationale Krankenversicherungslösungen spezialisiert ist. Auswirkungen auf den Versicherungsschutz hatte die vorzeitige Rückkehr von Expats dabei nicht, so die Vertriebsdirektorin des Krankenversicherers. Zudem biete AXA verschiedene Tarife, die auch den Versicherungsschutz von Expats für einen bestimmten Zeitraum im Heimatland beinhalten. In Ausnahmesituationen hätte man diesen in der Vergangenheit verlängert, um Mitarbeitende, die in Krisengebiete entsendet waren und in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, bestmöglich zu schützen.
Die gesetzliche Fürsorgepflicht bezieht sich im Grunde nur auf die Expats am Einsatzort. Doch einige Arbeitgeber übernehmen auch Verantwortung für Ortskräfte, die in ihren Niederlassungen im Krisengebiet tätig sind. „Unternehmen ist die Sicherheit ihrer Ortskräfte wichtig. Manche wollen diesen Beschäftigten die Möglichkeit geben, nach Deutschland zu kommen, damit sie ihre Arbeit hier weiterführen können.“ Dies erlebt Dr. Corinne Klapper, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei Advant Beiten, die im Immigration-Law-Team Mandanten dabei unterstützt, die notwendigen Aufenthaltstitel in Deutschland zu besorgen. Während es (arbeits-)rechtlich relativ unkompliziert ist, die in der Regel deutschen Staatsangehörigen aus den Krisengebieten abzuziehen, existierten dagegen etliche Hürden, die überwunden werden müssten, um Ortskräften aus Drittländern zu ermöglichen, nach Deutschland zu kommen.
Von Expats, die evakuiert wurden, berichtet auch Michael Weiss, Director Global Mobility bei Deloitte. Da sich aber in der Corona-Pandemie neue, technisch gestützte Einsatzformen teilweise bewährt hätten, „prüfen viele Arbeitgeber weltweit in Krisenregionen, ob Remote-Working oder hybride Entsendungen, die mit einem kurzen Aufenthalt vor Ort starten und remote fortgeführt werden, sinnvoll sind“.
Mit Blick auf die aktuellen Krisen und die der vergangenen Jahre resümiert Patrick Theobald, Gründer und Geschäftsführer der international tätigen Peakboard GmbH: „Die Welt wird nicht mehr normal. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass der nächste Krieg und die nächste Pandemie vor der Tür stehen. Wir werden uns eine gewisse Flexibilität in der internationalen Zusammenarbeit für die kommenden Krise angewöhnen müssen.“ Seine Einschätzung fand viel Zustimmung.
Compliance global – eine mühsame Materie
Die Global-Mobility-Expertinnen und -Experten von entsendenden Unternehmen und ebenso die der Beratungshäuser befinden sich außerdem im permanenten Ringen um Compliance: Die komplexen steuer-, sozialversicherungs-, aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Entwicklungen in und außerhalb der EU ändern sich je nach Land ständig, sodass Lösungen, die im Einklang mit Gesetzen und Regularien stehen, oft ein Kraftakt sind. Geschäftsführer Patrick Theobald schildert einige Erschwernisse aus seiner Sicht: Das Start-up Peakboard mit 35 Beschäftigten hat eine B2B-Software für industrielle Anwendungen entwickelt und folgt dem Prinzip „Work from Anywhere“. Seine Mitarbeitenden sitzen zum Teil in Deutschland, USA, Frankreich und in Drittländern. Der Geschäftsführer, der selbst zwischen Stuttgart, Taiwan und den USA pendelt, nennt ein Beispiel: Ein Mitarbeiter, französischer Staatsangehöriger, lebt in Frankreich und ist bei Peakboard in Deutschland angestellt. „Ich war der Meinung, dass dies im Zuge der europäischen Freizügigkeit kein Problem ist, das hat sich aber hinsichtlich der Sozial- und Krankenversicherung und auch der korrekten Versteuerung als sehr schwierig erwiesen. Ein dreiviertel Jahr später haben wir es immer noch nicht sauber geklärt.“
Eine Ursache liegt darin, dass es innerhalb von Europa große Unterschiede gibt. Im Prinzip sind die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Regularien angeglichen, „aber in jedem EU-Land kommen Anforderungen wie zum Beispiel Mindestarbeitsbedingungen hinzu, die überall variieren“, erklärt Corinne Klapper von Advant Beiten. In Belgien gelte zum Beispiel eine maximale wöchentliche Arbeitszeit von 38 Stunden, in einigen Branchen sogar weniger. Teilweise sei es dort möglich, länger zu arbeiten, im Gegenzug müsse der Arbeitgeber jedoch zusätzliche Urlaubstage und Überstundenzuschläge gewähren. Um die diversen länderspezifischen Vorschriften besser im Blick zu halten und managen zu können, hat die Kanzlei Advant Beiten ein digitales Tool entwickelt – und letztlich wieder eingestellt. Der Grund: Da die fortlaufenden Aktualisierungen für alle Länder bisher noch händisch vorgenommen werden müssen, stellt das Tool keine entscheidende Arbeitserleichterung dar. Kann an dieser Stelle eine KI-Lösung helfen?
Info
Nachhaltige Global-Mobility-Politik
International tätige Unternehmen müssen und wollen die ESG-Regeln und die Kriterien von Diversity, Equity und Inclusion (DE&I) auch im Global-Mobility-Management anwenden. Vor allem bei den Ausschreibungen schauen die Einkaufsverantwortlichen seit einigen Jahren immer genauer hin, berichtet Giovanni De Carlo von Crown World Mobility. Die Anbieter müssten immer länger werdende Fragenkataloge beantworten und spezifische Dokumente sowie Zertifikate vorlegen, die ihre nachhaltige Politik belegen. „Global Mobility muss auf jeden Fall ihren Beitrag zur Zielerreichung leisten.“ Dieser sollte aber auch das Verhalten der Expats einschließen. So sei zum Beispiel eine möblierte Mietwohnung viel nachhaltiger als ein kompletter Umzug mit dem ganzen Hausstand, der in Containern verschifft werde. Crown World Mobility arbeitet daran, für seine Relocation-Dienstleistungen einen Nachhaltigkeitsindex auszuweisen, damit die Kunden bei der Zusammenstellung ihrer Relocation-Pakete den Co2-Ausstoss reduzieren und sich energiebewusster verhalten können. Erstaunlicherweise sprechen Arbeitnehmer vor einer Entsendung von sich aus das Thema Nachhaltigkeit selten an. Das beobachtet Michael Weiss von Deloitte: „Nachhaltigkeitsziele werden eher top-down im Unternehmen implementiert.“ Auch er hat bei Entsendungen den Co2-Fußabdruck des Umzugs im Blick. Das Global-Mobility-Management könne seinen Beitrag leisten, indem es Expats zum Beispiel anrege, vielleicht in eine möblierte Unterkunft zu ziehen.
IT-Lösungen, die automatisch neue länderspezifische Regelungen einspielen können, befinden sich im Aufbau, erläutert Michael Weiss, Director Global Mobility bei Deloitte. Bisher genutzte manuelle Compliance-Check-Tools würden mehr und mehr durch KI-basierte automatisierte Compliance-Checks abgelöst. Funktionierende KI-Lösungen, die eine Aktualisierung von Entsendungsvorschriften automatisch erlauben, würden auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen und sich nach und nach etablieren. „Zum einen erleichtert KI deutlich die Einhaltung von Compliance und das Reporting bei grenzüberschreitenden Einsätzen; zum anderen sind – wenn Prüfungen seitens der Behörden anstehen – die notwendigen Dokumente komfortabler zugänglich.“ Darüber hinaus ermöglichen KI-gestützte Predictive Analytics auf Basis historischer Daten, potenzielle Compliance-Probleme vorherzusagen. Dieser proaktive Ansatz erlaube es Unternehmen, präventiv Maßnahmen zu ergreifen, um die Befolgung von Vorschriften zu gewährleisten.
Auch Crown World Mobility nutzt IT-Tools in Compliance-Fragen und legt Wert darauf, mit den neuesten technologischen Lösungen Schritt zu halten. Der Grund: „Auch Ämter und Behörden arbeiten mit automatisierten Tools und erhalten immer mehr Möglichkeiten, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu überprüfen“, argumentiert Giovanni De Carlo. Er rät Unternehmen dringend, die Perspektive zu wechseln – unabhängig davon, ob eine Softwarelösungen mit oder ohne KI laufe. „Sich darauf zu verlassen, dass Mobility-Gepflogenheiten unter dem Radar erfolgen können, ist keinem Unternehmen zu empfehlen.“
Work from Anywhere sind enge Grenzen gesetzt
Heute hier, morgen dort … – der Traum von vielen Beschäftigten nach längeren Workation-Phasen und ebenso der von Expats, die am Einsatzort längere Zeit remote arbeiten möchten, zerplatzt in den meisten Fällen. „Work from Anywhere kann nicht legal sein. Die Idee, dass Mitarbeitende dauerhaft aus dem Ausland für ihren deutschen Arbeitgeber arbeiten, mag schön klingen, aber funktioniert nicht“, sagt Omer Dotou von BDAE, der seine provokante These begründet: In und nach der Corona-Pandemie existierten zahlreiche Sonderregelungen für Remote-Working und Homeoffice-Tätigkeit im Ausland, die bereits im Jahr 2023 ausliefen oder gekündigt wurden. Inzwischen beschäftigen sich die Behörden zunehmend mit Compliance-Themen – und zwar weltweit. „Die unterschiedlichen Auffassungen und Regelungen zu kennen, stellt dabei die größte Herausforderung für Entsendungs- und Personalverantwortliche dar.“ Der Umfang der rechtlichen Anforderungen, die geklärt werden müssten, ist enorm und unmittelbar davon abhängig, ob es sich um Workation oder Homeoffice im EU-Ausland oder aber in einem Drittland handelt.
Info
Generationsunterschiede der Expats berücksichtigen
Es liegt auf der Hand, dass die Gen Z andere Erwartungen an Arbeit und auch an Entsendungen als die Babyboomer-Generation hat. Arbeitgeber müssen sich auf ein neues Anspruchsdenken einstellen, insbesondere beim Thema Wochenarbeitszeit. „Wir spüren immer wieder den mehr oder weniger deutlichen Unwillen einer 40-Stunden-Woche gegenüber. Die GenZ legt ihren Fokus auf ‚Life-Work-Balance‘ – ob es einem passt oder nicht“, sagt Patrick Theobald von Peakboard, der keinen Hehl daraus macht, dass es ihm nicht passt.
Das Mobility-Management steht nicht nur hinsichtlich der Arbeitszeiten vor neuen Herausforderungen. So machen junge Fachkräfte aus Deutschland ihre Entscheidung für einen Auslandseinsatz häufiger vom Entsendeziel abhängig. Die großen Metropolen wie Sydney, New York oder London sind beliebt, berichtet Michael Weiss von Deloitte, „abseits davon oder im ländlichen Bereich sinkt die Motivation für einen Aufenthalt deutlich“. Das Anspruchsdenken in der westlichen Arbeitswelt scheine bei jungen Menschen in vielen Fällen ausgeprägter als zum Beispiel im asiatischen Raum. Seine Erfahrung: Größere Unternehmen berücksichtigten durchaus die Generationsunterschiede, das finde sich auch in den Policies wieder. Zum Beispiel ließen sich jüngere Mitarbeitende von einer Person aus dem Freundeskreis beim Umzug und beim Einleben begleiten, und „Arbeitgeber übernehmen die Reise- und Unterkunftskosten für die begleitende Person“.
Die Gen Z fordert vor einer potenziellen Entsendung, dass der Arbeitgeber die individuelle Lebenssituation berücksichtigt. Daher rät Giovanni De Carlo von Crown World Mobility zu dem Core-Flex-Ansatz, der Unternehmen und angehenden Expats viel Flexibilität erlaubt: Bestimmte Leistungen werden als Basisleistungen definiert, die jeder und jedem Entsandten gewährt werden. Compliance-relevante Voraussetzungen, wie die Beantragung der Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung, seien in der Regel Core-Elemente und nicht verhandelbar. Aber Beschäftigte können ihr Relocation-Paket individuell mit zusätzlichen Dienstleistungen wie Wohnungssuche, Sprachkurse, interkulturelles Training oder Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung des Partners oder der Partnerin zusammenstellen, bis ein vorgegebenes monetäres Budget erreicht ist. „Eine 40-seitige Entsenderichtlinie, in der alles ausdefiniert ist, kommt dagegen bei jungen Menschen nicht gut an.“
Die Erfahrung von Omer Dotou: Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland erlaubt inzwischen Workation nur noch für maximal 30 Tage im Jahr und üblicherweise für den EU-Raum. Beschäftigten mit Drittstaatsangehörigkeit würden Heimatbesuche erlaubt. „Bei diesem Vorgehen sind sozialversicherungs- und steuerrechtliche Risiken eingeschränkt und beherrschbar.“
Die Wahrnehmung, dass Arbeitgeber mittlerweile „Work from Anywhere“-Modelle zeitlich deutlich begrenzen, teilt Gisela Baum von AXA. Sie beobachtet die Entwicklung bei ihren Kunden: Gerade bei Remote-Arbeit setzten Unternehmen oft eine maximale Anzahl an Tagen für mobiles Arbeiten im Jahr fest, „eben auch aufgrund der sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Risiken“. Abgesehen davon nehmen Arbeitgeber, die in der Produktion und Fertigung in Deutschland tätig sind, wieder Abstand von Homeoffice- und Workation-Modellen, „um alle Beschäftigten gleich zu behandeln“, registriert Michael Weiss von Deloitte. Geht es aber um eine Remote-Work-Policy für diejenigen Mitarbeitenden, die im Ausland im Einsatz sind, sei eine rechtssichere Lösung durchaus möglich. Allerdings mit einer „einer gewissen Risikobereitschaft: Unternehmen können eine rechtlich saubere Lösung erstellen, wenn sie den Einsatz unter gewissen Voraussetzungen genehmigen, die Komplexität in den Griff bekommen und den großen administrativen Aufwand sowie mögliche hohe Kosten nicht scheuen.“ Die Europäische Entsenderichtlinie habe Mindeststandards für Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen festgelegt – ein gut gemeintes Ziel –, wie Michael Weiss anmerkt. Jedoch erweise sich die administrative Umsetzung in der Praxis als kompliziert und aufwendig, da es signifikante Unterschiede in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten gibt.
Arbeitgeber, die „Work from Anywhere“-Policies aufsetzen, müssen bestimmte Limits setzen, bekräftigt auch Giovanni De Carlo von Crown World Mobility. Wenn eine Firma mit Zero Tolerance Compliance werbe, haben sie nur wenige rechtssichere Lösungen, die dauerhaft ein Arbeiten von jedem Ort aus in der Welt ermöglichen. „Außerdem müssen Unternehmen sicherstellen, dass personenbezogene Daten geschützt sind, also die Mitarbeitenden aufklären, wie sie mit der Übermittlung von sensiblen Informationen umzugehen haben.“ Arbeitnehmer seien verpflichtet, sichere Kommunikationsmittel und verschlüsselte Verbindungen für ihre Laptops zu nutzen, insbesondere wenn sie außerhalb des Unternehmensnetzwerks und außerhalb der EU arbeiten. Diese Einschränkungen seien noch nicht allen bewusst.
Info
Das Wichtigste in Kürze
- Arbeitgeber prüfen weltweit in Krisenregionen, ob Remote-Working oder hybride Entsendungen sinnvoll sind.
- Die Europäische Entsenderichtlinie hat Mindeststandards für Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen festgelegt, aber es gibt signifikante Unterschiede in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten.
- Nur bei einer Workation-Phase für maximal 30 Tage im Jahr und im EU-Raum sind die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Risiken eingeschränkt und beherrschbar.
- Homeoffice von Expats am Entsendeort rechtssicher umzusetzen, funktioniert nur unter gewissen Voraussetzungen und ist möglicherweise mit hohen Kosten verbunden.
- Remote-Worker in einem Drittland legal zu beschäftigten, bringt nicht selten eine Betriebsstättengründung mit sich.
- Größere Unternehmen berücksichtigen die Generationsunterschiede der Expats auch in den Policies.
- Der Fachkräftemangel macht auch vor den Global-Mobility-Abteilungen nicht halt. Unternehmen prüfen das Outsourcing von Teilbereichen.
Wie gelingt rechtssicheres Remote-Working aus einem Drittland?
Wenn Start-ups, KMU oder große Konzerne einzelne Mitarbeitende aus einem Drittland anwerben und dauerhaft mit ihnen remote zusammenarbeiten wollen, wird es rechtlich besonders kompliziert. Patrick Theobald von Peakboard möchte von den Expertinnen und Experten wissen, welche Wege es gibt, um solche Personen rechtssicher zu beschäftigen. Für KMU liegt der wirtschaftlichste Weg darin, die Regionen – also das ‚Anywhere‘ – einzuschränken, rät Arbeitsrechtlerin Corinne Klapper von Advant Beiten. Wer Mitarbeitende in einem außereuropäischen Staat remote beschäftigt, könne in diesem Land weiteres Personal suchen. „Auf diese Weise lässt sich zumindest der Umfang der zu berücksichtigenden länderspezifischen Einzelfallregelungen und Verwaltungspraktiken eingrenzen. Der Königsweg hieße dann ‚Work from somewhere‘.“ Die Kehrseite der Medaille läge allerdings darin, dass mit der Anzahl der Mitarbeitenden pro Land auch das Risiko steige, dort eine steuerrechtliche Betriebsstätte begründen zu müssen. Hierfür sei jedoch in aller Regel auch relevant, welche Tätigkeiten die Beschäftigten im Ausland erbringen. Eine Lösung von der Stange, so Corinne Klapper, sei nicht in Sicht, sondern stets vom Einzelfall abhängig.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass diese Beschäftigten in einem Drittland in ein europäisches Land übersiedeln, um von dort weiterzuarbeiten. Da aber viele Arbeitnehmer ihre Heimatregion aus verständlichen Gründen nicht verlassen wollen, falle diese Lösung meistens aus, merkt Giovanni De Carlo von Crown World Mobility an. Eine weitere Alternative stelle eine Employer-of-Record-Konstruktion (EOR) dar. Der EOR, also der Arbeitnehmerüberlasser im Drittland, ist dabei der gesetzliche Arbeitgeber des Mitarbeitenden, der auch für die rechtlichen Pflichten einschließlich Gehaltsabrechnung, Steuern, Sozialleistungen und Compliance verantwortlich ist. De Carlo: „Diese Lösung kann auf Dauer jedoch teuer werden.“
Das EOR-Modell beurteilen die Mobility-Expertinnen und -Experten auch aus anderen Gründen kritisch. Gisela Baum von AXA mahnt, dass Unternehmen bei diesem Konstrukt Kontrolle abgeben, weil sie sich nicht darauf verlassen können, dass Sozialversicherung und Steuern richtig abgeführt werden. „Eine wirkliche Rechtssicherheit haben deutsche Unternehmen mit dieser Lösung nicht.“
Info
Die Entsendung von morgen und der Fachkräftemangel
„Die Pandemie hat zwar Entsendeformen verändert, aber der digitale Auslandseinsatz hat sich bei unseren Kunden nicht durchgesetzt“, stellt Gisela Baum von AXA fest. Unternehmen setzten nach wie vor auf die klassische physische Entsendung, der Bedarf sei weiterhin vorhanden. Ebenso beobachtet sie, dass es Unternehmen nicht leichter falle, jüngere Mitarbeitende zu motivieren, im Ausland zu arbeiten. „Vielleicht aus diesem Grund lässt sich eine Tendenz erkennen, dass Unternehmen zunehmend erfahrene Beschäftigte neu entsenden oder den Einsatz von Expats verlängern.“
Den vermehrten Einsatz sogenannter Silver Ager im Ausland können die Diskussionsteilnehmer bestätigen. Doch auch dieser Weg kann nicht alle Bedarfe abdecken. Daher ist es unumgänglich, „dass der Fachkräftemangel zu neuen Einsatzlösungen führen muss, die die individuellen Bedürfnisse verschiedener Generationen und Mitarbeitendengruppen berücksichtigen“, ergänzt Michael Weiss von Deloitte. Sicherlich werde es Long- und Short-Term-Assignments weiterhin geben, aber gleichzeitig rücke Employee Experience in den Vordergrund.
Der Fachkräftemangel macht aber auch vor den Global-Mobility-Abteilungen nicht halt: Schon jetzt ist es für Unternehmen schwierig, den sehr unterschiedlichen Anforderungen personell gerecht zu werden – und dieser Trend wird sich verstärken, prognostiziert Michael Weiss. Unternehmen überlegten daher, welche Aufgaben sie Inhouse abdecken können und wollen und welche sie extern auslagern, um mehr Kapazitäten für die Beratung sowie Aufgaben der Business Partner intern freizusetzen. Administrative Aufgaben ließen sich leicht an externe Dienstleister übertragen, wenn im Unternehmen keine Technologie bereitsteht, die automatisierte Abläufe übernimmt.
Wirklich rechtssicher agieren Unternehmen, die Arbeitnehmer in einem Drittland remote beschäftigen wollen, nur dann, „wenn sie über die Gründung einer Betriebsstätte nachdenken“, stellt Omer Dotou von BDAE klar: „Mit dieser Lösung verhalten sie sich zu 100 Prozent legal.“ Die Mitarbeitenden unterliegen dann nicht dem deutschen, sondern dem dortigen Arbeitsrecht ebenso wie dem länderspezifischen Sozialversicherungs- und Steuersystem. Natürlich könne eine Gründung von Niederlassungen in zwei oder drei Ländern kostenintensiv sein, „aber diesen Weg empfehlen wir unseren Mandaten als strategische Lösung, insbesondere mit Blick auf die künftigen Fachkräfte, die unkompliziert über die bereits etablierten Strukturen angestellt werden“. Für Unternehmen, die nur vereinzelt Mitarbeitende aus einem Drittland arbeiten lassen, sei diese Lösung wirtschaftlich jedoch unattraktiv.
Dies kann Patrick Theobald umgehend bestätigen. Eine Betriebsstättengründung in einem Drittland sei für ein Start-up wie Peakboard, das noch von Fördermitteln finanziert wird, keine gangbare Alternative. „Wir können nicht für ein oder zwei Mitarbeitende in einem Land eine Betriebsstätte gründen. Da stehen Kosten und Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Eine Betriebsstättengründung nur für den Zweck der korrekten Abwicklung der Anstellung ist meiner Ansicht nach nur großen Mittelständlern und Konzernen vorbehalten und keine Option für kleine Firmen.“
Christiane Siemann ist freie Wirtschaftsjournalistin und insbesondere spezialisiert auf die Themen Comp & Ben, bAV, Arbeitsrecht, Arbeitsmarktpolitik und Personalentwicklung/Karriere. Sie begleitet einige Round-Table-Gespräche der Personalwirtschaft.