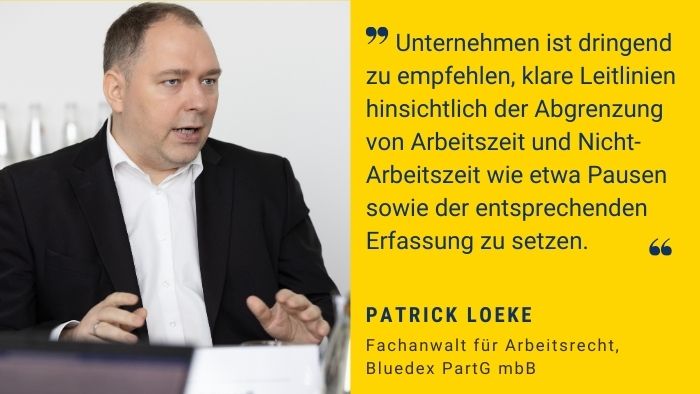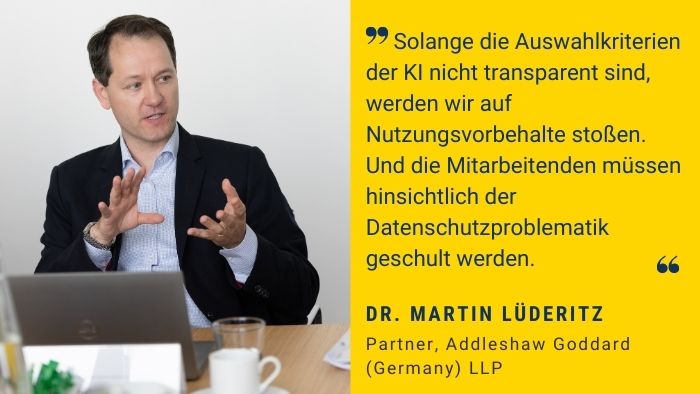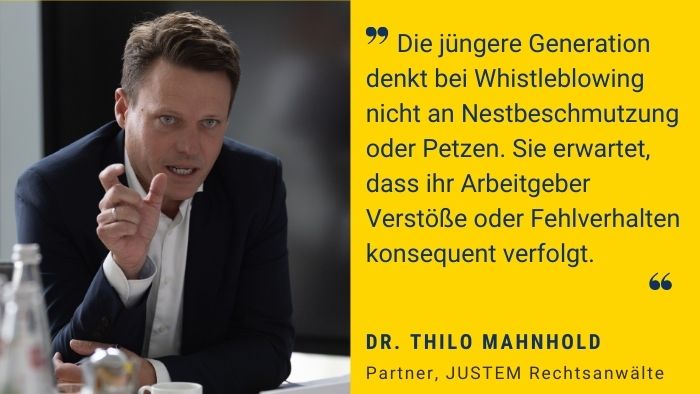Größer könnte der Kontrast nicht sein: Auf der einen Seite drängt im gesetzlichen Arbeitsverhältnis alles in Richtung Transparenz (Stichwort Whistleblower-Schutz, Arbeitszeiterfassung, Entgeltgleichheit und anderes). Auf der anderen Seite schleichen sich in betriebliche Arbeitsabläufe – vom Shop Floor bis zum HR-Management – Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) ein, deren Algorithmen für Entscheidungspfade komplett im Dunkeln liegen. Welche Spannungsfelder und Herausforderungen für Arbeitgeber in diesen konträren Entwicklungen liegen, erörterten Arbeitsrechtler und -rechtlerinnen unterschiedlicher Kanzleien beim Round Table im F.A.Z. Tower in Frankfurt.
Zunächst knüpften sie sich das neue Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) vor, das am 2. Juli 2023 in Kraft getreten ist und neue Pflichten für Unternehmen mitbringt. Es basiert auf einer EU-Richtlinie, die eine Umsetzung in nationales Recht bis Ende 2019 verlangt hatte. Doch der deutsche Gesetzgeber nahm ein Vertragsverletzungsverfahren in Kauf, weil bis zur letzten Minute gestritten wurde. Inzwischen hat er sich festgelegt und die Richtlinie mit einigen Abweichungen in das HinSchG aufgenommen. Fragt sich: Ist das ursprüngliche Ziel erreicht worden? Können Hinweisgeber ohne Angst vor Repressalien Missstände melden?
Anonym oder nicht: Ist das hier die Frage?
Umstritten war im gesetzgeberischen Entscheidungsprozess die Frage, ob und inwieweit auch anonyme Meldungen zulässig sein sollen beziehungsweise verfolgt werden müssen. Nicht nur die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), auch der Rechtsausschuss des Bundestags hatte den Gesetzgeber aufgefordert, seine skeptische Haltung gegenüber anonymen Hinweisen zu überdenken. Sie argumentierten: Häufig hänge die Bereitschaft, Verstöße zu melden, davon ab, anonym bleiben zu können. Doch im Bundesrat fehlte die Zustimmung für die komplette Anonymität. So einigte man sich am Ende auf eine abgeschwächte Form: Das Gesetz gibt lediglich vor, dass die Meldestellen auch anonym eingehende Hinweise bearbeiten sollen. Die Pflicht, Meldekanäle einzurichten, die keine Rückschlüsse auf die Identität des Hinweisgebers hinterlassen, wird es nicht geben. Konterkariert diese Entscheidung die Absichten des HinSchG? Die Einschätzungen der Arbeitsrechtsexperten und -expertinnen sind durchaus unterschiedlich.
„Das Inkognito wird überschätzt“, sagt Dr. Alexander Insam, Partner bei Görg Rechtsanwälten. Zum einen müsse bereits jede Ombudsperson die Daten des Hinweisgebers vertraulich behandeln und auf Wunsch Anonymität gegenüber Dritten gewährleisten. Zum anderen müsse grundsätzlich zwischen zwei Situationen unterschieden werden: Wenn beispielsweise Mitarbeitende einen vermutlichen Korruptionsfall beobachten, könnten sie der Ombudsperson einen Tipp geben und sich zurückziehen, weil die interne Revision oder Compliance-Verantwortliche den Sachverhalt aufklären werde. Solche Fälle erforderten nicht, die Anonymität aufzugeben. Anders verhalte es sich, wenn Hinweisgebende als Zeugen benötigt würden. Zum Beispiel, wenn sie selber Betroffene oder Opfer seien wie etwa bei einem Fall von Mobbing. Insam verweist auf die Praxis: „Will das Unternehmen einen gemeldeten Vorfall aufklären und richtig ermitteln, müssen Ross und Reiter klar benannt werden, auch um potenzielle Täter vor falschen Verdächtigungen zu schützen.“ Gerade ohne weitere Zeugen stelle sich regelmäßig die Frage: „Ist der Hinweisgebende zur Aussage bereit? Wenn nicht, steht letztlich oft Aussage gegen Aussage.“
Info

Berichte zu unseren Round Tables finden Sie auf unserer Übersichtsseite.
In internationalen Konzernen stellt ein Inkognito-Hinweis grundsätzlich kein problematisches Thema dar, entgegnet Dr. Thilo Mahnhold, Partner bei JUSTEM. Aufgrund der US-amerikanischen Compliance-Regelungen sei die anonyme Meldung schon lange Standard. Aus seiner Sicht ist eher der Schutz des Hinweisgebers ein kritischer Bereich. Viele Studien aus den USA zeigten, dass Whistleblower nach einigen Jahren nicht mehr im gleichen Unternehmen arbeiten. Wo liegen die Gründe dafür? Vermutlich in der Handhabung der internen Aufklärungsprozesse. Wenn Personen befragt würden, bleibe das nicht unbeobachtet, der Flurfunk nehme seinen Lauf und Gerüchte verbreiteten sich schnell. Mahnholds Fazit: „Welcher Schutz auch immer aufgebaut wird, die Rolle des Whistleblowers bleibt brisant“.
Für eine bessere Aufklärung der potenziellen Hinweisgebenden plädiert Annabel Lehnen, Partnerin bei Osborne Clarke. Sie sollten gut belehrt werden, welche Abläufe auf sie zukommen könnten. Die Arbeitsrechtlerin würde es begrüßen, wenn in einer Betriebsvereinbarung oder einer Policy „die Kette der Untersuchungen und die Pflicht des Meldenden, gegebenenfalls in einem späteren Gerichtsverfahren auch eine Zeugenaussage tätigen zu müssen, so transparent formuliert sind, dass jeder vollumfänglich im Bilde ist.“
Präventive HR-Compliance
Wie auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) bestehe beim HinSchG die Gefahr des Missbrauchs: „Whistleblower könnten versuchen, den durch das Gesetz verliehenen Schutz im Kampf gegen Kündigungen zu missbrauchen“, bemerkt Dr. Martin Lüderitz, Partner bei Addleshaw Goddard. Als Beispiel führt er Fälle aus Großbritannien an: Wenn es dort einem Arbeitnehmer gelinge, einen Zusammenhang zwischen Kündigung und vorheriger Meldung eines Missstands herzuleiten, genieße er schon vor Ablauf der dort geltenden zwei Jahre Dienstzeit den Kündigungsschutz und umgehe die Kappung von Abfindungen. Letztlich ist Lüderitz aber optimistisch, „dass deutsche Arbeitsgerichte mit Augenmaß handeln und bei Verdacht auf Missbrauch kritisch prüfen“.
Auch Patrick Loeke, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Bluedex, hat Bedenken vor einer missbräuchlichen Anwendung des HinSchG in Kündigungsschutzverfahren. Der Arbeitgeber müsste dann aufgrund der im Gesetz vorgesehenen Beweislastumkehr darlegen, aus anderen Gründen gekündigt zu haben. „Selbst wenn sich Arbeitgeber rechtstreu verhalten haben, dürfte damit ein Restrisiko verbleiben, das Gericht nicht vollends überzeugen zu können.“
Ohne Zweifel haben Meldungen, die in der Hotline ankommen, eine große Macht. „Sie können Personen desavouieren, und es ist ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass sie als taktisches Instrument eingesetzt werden, um Kandidaten oder Kollegen zu schaden“, ergänzt Thilo Mahnhold von JUSTEM. Letztendlich geht er jedoch von einem positiven Einfluss des HinSchG auf die Unternehmenskultur aus. Die jüngere Generation – auch angestoßen durch die MeToo-Diskussion – denke bei Whistleblowing nicht mehr in Kategorien von Nestbeschmutzung oder Petzen. Sie erwarte, dass ihr Arbeitgeber Verstöße oder Fehlverhalten konsequent verfolgt. Diese Aufmerksamkeit führe dazu, dass die Missstände oder internen Beschwerden, die bisher nicht wirklich aufgegriffen wurden, nun relevant für Compliance-Verantwortliche werden. Als Beispiele nennt er Fälle von sexueller Belästigung, Fragen zur Arbeitszeit und alles rund um das Thema Scheinselbstständigkeit. „Die präventive HR-Compliance erhält ein noch größeres Gewicht.“
KI-Integration in Arbeitsprozesse kritisch abwägen
Der auf Künstlicher Intelligenz (KI) beruhende Chatbot ChatGPT, der unter anderem textbasierte Inhalte erstellt, hat der Diskussion um den Einsatz von KI am Arbeitsplatz eine neue Dynamik verliehen. Theoretisch kann diese Anwendung komplette Arbeitsprozesse übernehmen und zum Beispiel Schriftsätze verfassen, Stellenausschreibungen, Abmahnungen und Kundenanschreiben formulieren und vieles mehr. Wie sieht es in der Praxis aus?
„ChatGPT ist bislang keine betrieblich genutzte KI“, sagt Alexander Insam von Görg. Eine Integration in die Software der Unternehmen hat er noch nicht beobachtet. Möglicherweise auch, weil Arbeitgeber erkennen, dass ChatGPT aktuell eine Blackbox ist: Sie können nicht erkennen, wie die Informationen verarbeitet werden und welche Entscheidungspfade und Algorithmen hinterlegt sind. So entstehen rechtliche Risiken vor allem hinsichtlich Reputation und Haftung. Aus seiner Sicht müssten sich Arbeitgeber die zentrale Frage stellen, „ob ihre Beschäftigten ChatGPT mit Firmeninfos und Betriebsgeheimnissen ‚aufschlauen‘ sollen, denn alle Daten, die als Arbeitsauftrag eingegeben werden, dienen dazu, die KI weiterzuentwickeln“. Davon partizipiert aber das Unternehmen wirtschaftlich nicht und „verschenkt quasi Arbeitskraft und Know-how“. Zusätzlich kommt es zu Problemen mit dem Datenschutz der Mitarbeitenden und dem Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Dass in Zukunft erstmals die Integration von ChatGPT in die MS-Office-Welt bevorsteht, beurteilt er aus Unternehmenssicht kritisch: „In diesem Fall muss gewährleistet sein, dass nur das Unternehmen Zugriff auf seine Daten und Betriebsgeheimnisse hat.“
Nichtsdestotrotz erwägen Unternehmen derzeit nicht nur teilautomatisierte, sondern auch generative KI-Anwendungen in ihre Arbeitsprozesse einzubinden, „weil sie zuverlässigere Ergebnisse erwarten“. So erlebt es Martin Lüderitz von Addleshaw Goddard, der gleichzeitig feststellt, dass KI-Systeme genau diese Zuverlässigkeit noch nicht bieten können. Untersuchungen in den USA haben ergeben, dass KI-gestützte Lösungen bei der Bewerberauswahl zu mehr Diskriminierungen führen können. „Solange die Auswahlkriterien und Algorithmen nicht transparent sind, werden wir auf Nutzungsvorbehalte stoßen. Die Anwendung sogenannter intelligenter Software setzt zudem Mitarbeitende voraus, die hinsichtlich der Datenschutzproblematik geschult sind.“ Als Beispiel nennt Lüderitz den Umgang mit automatisierten Übersetzungsprogrammen. Letztlich müsse jeder Text, der im Arbeitsumfeld übersetzt werden solle, vorher von (Kunden-)Daten und anderen Geschäftsgeheimnissen fehlerfrei bereinigt werden – was durchaus aufwendig sei.
Wo bleibt die „höchstpersönliche Arbeitsleistung“?
Eine weitere offene Flanke bei der Nutzung von KI und Co: Immer mehr Beschäftigte werden die Anwendungen als Arbeitserleichterung ansehen und entsprechend verwenden. „Das deutsche Arbeitsrecht schreibt jedoch eine höchstpersönliche Arbeitsleistung vor, die der Beschäftigte nicht ohne das Einverständnis des Arbeitgebers einfach auf andere übertragen kann“, sagt Patrick Loeke von Bluedex. Es seien bereits Einzelfälle bekannt geworden, in denen hochbezahlte IT-Mitarbeitende ihre Programmiertätigkeiten durch die Eingabe in KI-Anwendungen haben erledigen lassen. Ist das noch eine höchstpersönliche Arbeitsleistung? Aus Arbeitgebersicht stellten sich somit grundsätzliche Fragen: Erlauben sie die Nutzung von KI-Lösungen? Falls ja, für welche Tätigkeiten und in welchem Umfang? Wie können Vorgesetzte überhaupt kontrollieren, ob Mitarbeitende (unerlaubt) auf KI-Lösungen zurückgreifen? Loeke rät Unternehmen nicht nur aus Gründen des Datenschutzes und der Geschäftsgeheimnisse, „sich mit dem Thema eingehend zu befassen und den Arbeitnehmenden klare Weisungen im Rahmen ihres Direktionsrechtes zu erteilen“.
Für Annabel Lehnen von Osborne Clarke liegt eine besondere Herausforderung darin, dass KI-Lösungen „nach und nach und zum Teil unbemerkt immer mehr in arbeitsrechtlich relevanten Alltagssituationen eingesetzt werden“. Ebenso dürfte aus ihrer Sicht die Mitbestimmung der Betriebsräte schwieriger werden, weil die täglichen Abläufe technisch eine Eigendynamik entwickeln werden. „Es wird neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsräten hierzu geben müssen.“ Was also können Arbeitsrechtler Unternehmen raten? „ChatGPT ist ein Motor für neue KI-Policies. Bisher empfehlen wir unseren Mandanten, ihren Fokus unter anderem auf die Geschäftsgeheimnisse zu legen“, sagt Thilo Mahnhold von JUSTEM. Gleichzeitig befürchtet er, dass Unternehmen nicht besonders konsequent handeln werden: Mit Microsoft Teams wollten viele zunächst nicht arbeiten, weil sie die 90-Tage-Speicherfrist und die Ungewissheit der Datenverwendung fürchteten. Später haben sich aber nur wenige Arbeitgeber darauf besonnen und in der Folge eine andere, sicherere Konferenzplattform installiert. Heute schaffe die Praktikabilität der MS-Office-Anwendungen Fakten. Die Liste der offenen Fragen bei der Anwendung von KI sei jedoch viel länger: vom Datenschutz über Urheberrecht bis zur Frage, wie eine unerlaubte Nutzung identifiziert werden kann – und ob grundlegend neue Arbeitsmethoden und Organisationsstrukturen entstehen. „Spätestens bei der nächsten Generation der KI-Tools wird man Antworten finden müssen.“
Speziell an Personalverantwortliche richtet sich die Empfehlung von Alexander Insam von der Kanzlei Görg: „KI-Lösungen für HR stehen erst am Anfang, und die Entscheider sollten nicht einfach auf den Zug aufspringen, sondern den Einsatz kritisch abwägen.“ Seine Begründung: Das große Heilsversprechen von KI – „es gibt einen Algorithmus und der behandelt alle gleich“ – sei brüchig. „Wir wissen nicht, wie er arbeitet und ob er nicht alles ungleicher macht.“ Der Algorithmus könne nicht einfach decodiert werden, um seine Entscheidungskriterien sichtbar zu machen. „Eine gewisse Vorfilterung bei Bewerbungen kann sinnvoll sein, aber eine echte Selektion ist derzeit noch zu fehleranfällig und widerspricht den rechtlichen Anforderungen des AGG.“
Zeiterfassung im Fokus: das starre Korsett
Mit dem Urteil vom 13. September 2022 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) klargestellt, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, ein System einzuführen, mit dem die geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. Wie ist der Status quo? Nehmen die Unternehmen das BAG ernst, oder warten sie weiter auf den Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium? Kurzes Zögern der Arbeitsrechtler und -rechtlerinnen, dann lautet ihre Antwort: „Fifty-fifty.“ Solange noch keine Strafen drohen, bestehe für viele Unternehmen kein Umsetzungsgrund. „Einerseits warten manche Unternehmen noch auf den Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil, andererseits ist in einigen Branchen das Stempeln beziehungsweise die Zeiterfassung ohnehin die Regel“, erläutert Martin Lüderitz. Der Arbeitsrechtler von Addleshaw Goddard schildert die Zwangslage, in die Arbeitgeber und Arbeitnehmende geraten: Für viele Bereiche passe die lückenlose Erfassung einfach nicht. „Mitarbeitende in kreativen, mobilen Arbeitsumfeldern fühlen sich eher kontrolliert, gerade wenn dort bislang Vertrauensarbeit galt.“
Auch technische Lösungen vereinfachten den Prozess nur bedingt. „Wir haben wenig Hoffnung in den Gesetzgeber, da er das Grundproblem – die Art und Weise, wie flexibel wir heute arbeiten – ignoriert und daher wohl zu keiner befriedigenden Lösung eines flexiblen Arbeitszeitgesetzes kommen wird.“ Viele Unternehmen und Verbände fordern aktuell vom Gesetzgeber, dass nicht nur leitende Angestellte, sondern auch Mitarbeitende in Vertrauensarbeitszeit sowie im Außendienst von der Verpflichtung zur Zeiterfassung ausgenommen werden. Unverständlich ist der Arbeitsrechtlerin Annabel Lehnen von Osborne Clarke, dass das deutsche Arbeitszeitgesetz „hinterherhinkt“: „Die EU ist schon einen Schritt weiter, denn Art. 6 EU-AZR kennt nur eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden. Das würde auch für deutsche Arbeitsverhältnisse mehr Flexibilität an den einzelnen Wochentagen ermöglichen.“ Gerade in den Dienstleistungsberufen, im Homeoffice und im Außendienst fehlen praktikable Lösungen, bekräftigt Thilo Mahnhold von JUSTEM. Er würde es begrüßen, wenn der Gesetzgeber dem Beispiel anderer EU-Mitgliedsstaaten folgt und weitere Ausnahmen vom Arbeitszeitschutzgesetz neben der des leitenden Angestellten formuliert. „Wenn wir über Arbeitszeiterfassung sprechen, führen wir eine Scheindiskussion und lenken vom Grundproblem ab, dass in der Politik die Courage fehlt, auf die heutige Arbeitswelt zu reagieren.“
Wenn eine detaillierte Erfassungspflicht kommt, die den Anfang, das Ende und die Pausen der Arbeitszeit betrifft, stellt sich für Unternehmen auch die Frage, in welchen Fällen sich Mitarbeitende zukünftig ein- und ausstempeln müssen. Arbeitsrechtler Patrick Loeke von Bluedex fragt sich, was zukünftig dann als Pause zählt. Der Gang zur Kaffeemaschine, das private Gespräch mit dem Kollegen oder jeder kurze Blick aufs private Handy? „Bislang war im Arbeitsalltag in der Regel ein gesundes Geben und Nehmen festzustellen. Wenn Arbeitgeber zukünftig jede Extraminute zahlen müssen, könnte dies durchaus dazu führen, dass auch bei den bislang hingenommenen kurzen Unterbrechungen genauer hingeschaut wird. Ein Verstoß wäre dann auch kein Kavaliersdelikt.“ Notiert der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zum Beispiel eine Pause zu Unrecht als weiterlaufende Arbeitszeit, bewegt er oder sie sich schnell im Bereich des Arbeitszeitbetrugs. Dieser könne unter Umständen zu einer berechtigten fristlosen Kündigung und sogar zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Loeke: „Arbeitgebern ist dringend zu empfehlen, klare Leitlinien hinsichtlich der Abgrenzung von Arbeitszeit und Nicht-Arbeitszeit sowie der entsprechenden Arbeitszeiterfassung zu setzen.“
Alexander Insam von Görg bedauert, dass die Sozialpartner nicht mehr Gestaltungsmacht bekommen werden. „Der Ausweg, mit Betriebsvereinbarungen abweichen zu können, wäre nicht nur für tarifgebundene Unternehmen sinnvoll, sondern auch für alle anderen. Auf diese Weise könnten die Interessen und Wünsche der Mitarbeitenden durch die Betriebspartner besser berücksichtigt werden.“ Außerdem verweist Insam auf das Urteil des BAG vom 13. September 2022, das die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung aus einer europarechtskonformen Auslegung hergeleitet hat. Diese könnte in Zukunft eine ganz andere Auswirkung auf den deutschen Gesetzgeber haben. „Die sogenannte Sozialtaxonomie, die für ‚Social‘ in den ESG-Kriterien steht, wird kommen.“ Die Taxonomie fokussiert sich unter anderem auf Mental Health, etwa auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Möglicherweise würde der EuGH dann in Zukunft feststellen, dass die Bestimmungen des deutschen Arbeitszeitgesetzes, wie die taggenaue Stundenerfassung oder die Beachtung von elf Stunden Ruhezeit, zu starr sind und gegen die ESG-Kriterien verstoßen.
Lohnlücken schließen
Am 6. Juni 2023 ist die europäische Entgelttransparenzrichtlinie (EU/2023/970) in Kraft getreten. Für Unternehmen bedeutet das: Sie sind verpflichtet, für mehr Lohntransparenz zu sorgen, und sie müssen ab 2026 das geschlechtsspezifische Lohngefälle offenlegen. Die EU-Richtlinie geht in vielen Punkten über die bereits bestehenden nationalen Gesetze hinaus. Ihr Fokus liegt auf einheitlichen Vergütungsstrukturen sowie umfangreichen Informationspflichten gegenüber Mitarbeitenden sowie Bewerberinnen und Bewerbern.
Die EU-Richtlinie, die sich nach ihrer Umsetzung in deutsches Recht noch besser beurteilen lässt, ist im Grunde sinnvoll, betont Arbeitsrechtler Patrick Loeke von Bluedex. Das bereits seit 2017 geltende Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) habe in der Praxis nur äußerst selten zu gerichtlichen Auseinandersetzungen oder zur Aufdeckung von Ungerechtigkeiten geführt. Ob sich dies tatsächlich ändere, wenn das neue Gesetz vorliege, bleibe abzuwarten. Nach seinen Erfahrungen stellen geschlechtsspezifische Ungleichbehandlungen in der Vergütung den absoluten Ausnahmefall dar. „Dies können sich Arbeitgeber heutzutage aus mehreren Gründen – zum Beispiel dem Wettbewerb um qualifiziertes Personal oder dem Risiko einer Imageschädigung des Unternehmens – schlicht nicht mehr leisten. Arbeitgebern ist bereits jetzt zu raten, umfassender zu dokumentieren, weshalb eine bestimmte Vergütung oder Einstufung erfolgt ist.“
Dieser Einschätzung schließt sich Martin Lüderitz von Addleshaw Goddard an. Es sei der Wettbewerb um begehrte Talente, der Unternehmen antreibe, beim Gehalt für mehr Entgeltgleichheit und Transparenz zu sorgen. Nicht wenige Betriebe stellten sich die Frage, ob transparentere Vergütungssysteme – etwa mit Gehaltsbändern – für Jobkandidatinnen und -kandidaten attraktiver seien. Auch spürten Arbeitgeber immer deutlicher, dass es Belegschaften demotivieren kann, wenn es Gehaltsunterschiede gibt, die sie nicht schlüssig erklären können. Problematisch wird die Beurteilung der Entgelttransparenz in Unternehmen, in denen unterschiedliche Vergütungsstrukturen historisch gewachsen sind oder in denen sogenannte High Performer mehr verdienen als vergleichbare Kollegen, wendet Annabel Lehnen von Osborne Clarke ein. „Die Frage einer fairen Vergütung und deren Transparenz wird auf Dauer nur in Form von Gehaltsbändern geordnet werden können, wenn es keine tariflichen Bestimmungen gibt.“ Da Mitarbeitende nach der Rechtsprechung des BAG jedoch nur „ihr persönliches, subjektives Leistungsvermögen angemessen ausschöpfen müssen“, sollte es sachlich gerechtfertigt sein, wenn Arbeitgeber sich dafür entscheiden, diese durchschnittlich geschuldeten Leistungen mit Gehaltsbändern abzudecken und Zusatzleistungen individuell nach bestimmten Kriterien darüber hinaus zu entlohnen.
Info
Das Wichtigste in Kürze
- Das Hinweisgeberschutzgesetz wird der präventiven HR-Compliance einen höheren Stellenwert geben, da Missstände oder internen Beschwerden, die bisher nicht aufgegriffen wurden, relevant für Compliance-Verantwortliche werden.
- ChatGPT ist keine Betriebssoftware. Arbeitgeber sollten die Anwendung in Hinsicht auf Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse und die höchstpersönliche Arbeitsleistung genau abwägen.
- Wenn die Integration von ChatGPT in die MS-Office-Welt kommt, muss gewährleistet sein, dass nur das Unternehmen Zugriff auf seine Daten und Betriebsgeheimnisse hat.
- Bei einer minutengenauen Arbeitszeiterfassung könnte sich das bisherige „Geben und Nehmen“ von Minipausen und Extraminuten zu einem Arbeitsrechtsverstoß einer der beiden Seiten auswachsen.
- Arbeitgeber sollten vergütungsrelevante Entscheidungen umfassender begründen und dokumentieren. Gehaltsbänder sind das Mittel der Wahl.
Die EU-Richtlinie bringt auf jeden Fall eine große Herausforderung mit sich, da das BAG die Vermutung einer Ungleichbehandlung gemäß § 22 AGG auf Ansprüche nach dem EntgTranspG überträgt. Somit muss der Arbeitgeber beweisen, dass keine Ungleichbehandlung vorliegt. Thilo Mahnhold von JUSTEM: „Das dürfte HR-Abteilungen eine Menge an Mehrarbeit bringen. Sie müssen sorgsam und diskriminierungsfrei dokumentieren, warum beispielsweise ein männlicher Kandidat mehr Gehalt bezieht als die ebenfalls eingestellte weibliche Kandidatin – und das im Grunde zum Zeitpunkt der Einstellungsentscheidung.“ Die transparente Dokumentation begünstige leider auch eine „Sammelwut“ von Daten und Unterlagen, die HR von anderen drängenden Themen abhalte.
Eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 16. Februar 2023 in Sachen Gehalt bewertet Alexander Insam von Görg als ärgerlich. Demnach können individuelle Gehaltsverhandlungen eine unterschiedliche Vergütung von Frauen und Männern für gleiche oder gleichwertige Arbeit nicht rechtfertigen können. Diese Haltung kritisiert Insam: „Verhandlungsgeschick in Gehaltserhöhungsdiskussionen sollte auch als Differenzierungsgrund geeignet sein. Es entsteht der Eindruck, als gäbe es gute objektive Gründe und schlechte objektive Gründe.“ Er plädiert für staatliche und richterliche Zurückhaltung. Die Mündigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei wichtig und in der aktuellen Marktsituation auch rechtlich vollkommen ausreichend.
Christiane Siemann ist freie Wirtschaftsjournalistin und insbesondere spezialisiert auf die Themen Comp & Ben, bAV, Arbeitsrecht, Arbeitsmarktpolitik und Personalentwicklung/Karriere. Sie begleitet einige Round-Table-Gespräche der Personalwirtschaft.